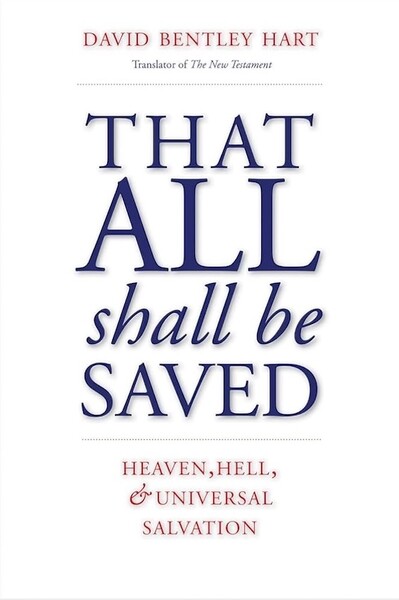
That All Shall Be Saved
Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen: David Bentley Hart von der University of Notre Dame gilt (zusammen mit John Milbank von der Nottingham University) weithin als einer der beiden einflussreichsten akademischen Theologen in der heutigen englischsprachigen Welt. Harts Arbeitspensum ist beeindruckend, und die Bandbreite seines intellektuellen Interesses (in den einschlägigen Werken mehrerer Sprachen) ist überwältigend. Seine 2004 veröffentlichte Dissertation The Beauty of the Infinite veranlasste Rezensenten dazu, ihn – trotz seines jungen Alters – als einen der führenden christlichen Theologen zu bezeichnen.
Obwohl Hart seine persönliche Bibliothek von etwa 20.000 Bänden verloren hat, scheint er das meiste davon gelesen und nicht viel vergessen zu haben. Wäre er früher geboren worden, wäre er wohl ein Gelehrter geworden, der neben C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien und den anderen Inklings im Pub „The Eagle and Child“ in Oxford gesessen haben könnte; und er hätte nicht nur ihren Gesprächen über englische Literatur, westliche Geschichte, Weltmythologie und christliche Theologie gelauscht, sondern ihnen auch das eine oder andere beigebracht. Wer dies für übertrieben hält, sollte einfach einen Blick in Harts jüngst erschienene Essaysammlungen werfen: A Splendid Wickedness and Other Essays (2016), The Hidden and the Manifest (2017) und The Dream-Child’s Progress (2017). Diese und andere Bände von Hart kann ich wärmstens empfehlen.
Harts Buch That All Shall Be Saved: Heaven, Hell, and Universal Salvation (dt. „Dass alle gerettet werden: Himmel, Hölle und universale Erlösung“) verdient meiner Meinung nach jedoch nicht dasselbe Lob und lässt auch die argumentative Schärfe und literarische Schönheit seiner früheren Werke vermissen. Kinofreunde würden es vielleicht als Der Pate III des Hart’schen Œuvres bezeichnen: nicht so ganz auf der Höhe. Selbst der Meister verfehlt manchmal sein Ziel. Zu meiner (und sicherlich vieler andere Leser) Enttäuschung kommt hinzu, dass Hart nicht mehr – wie noch in Atheist Delusions (2010) – den Unglauben bekämpft, sondern einen regelrechten Krieg gegen andere Christen führt, die an den traditionellen Vorstellungen von Himmel und Hölle festhalten.
Die These steckt im Titel: Alle Geschöpfe, die gegen Gott gesündigt haben, werden letztlich gerettet. Und Hart vertritt seine Überzeugung nicht als wahrscheinlich oder möglich, sondern als zweifelsfrei sicher. Er hat nichts übrig für einen „hoffnungsvollen Universalismus“ (eine Ansicht, die oft Karl Barth und Hans Urs von Balthasar zugeschrieben wird), der zwar offen dafür ist, dass alle Menschen gerettet werden, jedoch daran festhält, dass dies nicht mit Sicherheit behauptet oder im Voraus geklärt werden könne. Harts Buch könnte darauf hindeuten, dass es mit der Zurückhaltung der Universalisten nun vorbei ist: Fortan ist Bestimmtheit angesagt.
Meine eigene Debatte mit Hart über die Frage der universalen Erlösung reicht zurück bis in den Herbst 2014, als Hart sich der theologischen Fakultät der Saint Louis University anschloss, an der ich unterrichte und wo Hart ein Jahr lang eine Gastprofessur innehatte. Unsere frühen Gespräche antizipierten sowohl Harts Argumente in That All Shall Be Saved als auch die meinigen in meinem 2018 erschienenen The Devil’s Redemption: A New History and Interpretation of Christian Universalism (dt. „Des Teufels Erlösung: Eine neue Geschichte und Interpretation des christlichen Universalismus“). Ich sollte potentielle Leser jedoch vorwarnen, dass es sich um zwei sehr unterschiedliche Bücher handelt: Harts Werk ist ein persönliches Manifest von 214 Seiten (ohne Fußnoten oder Quellenangaben und mit nur minimalen Verweisen auf die komplexen historischen Universalismus-Debatten); mein Werk beläuft sich auf 1.325 Seiten, zitiert mehr als 3.000 Quellen und enthält etwa 3.500 Fußnoten. Douglas Farrow von der McGill University empfiehlt allen, die sich für Universalismus interessieren, beide Bücher zu lesen. Dem kann ich nur zustimmen.
Obwohl Hart vor intellektuellen Konfrontationen keineswegs zurückscheut, blieb ich während meiner Zeit mit ihm vor einer verbalen Abreibung verschont, aber ich war dabei, als er sich einen jüngeren thomistischen Philosophen unserer Universität vorknöpfte. Damals wurde mir bewusst, dass Vorstellungen von göttlicher Souveränität – ob thomistisch oder calvinistisch – Hart ein Gräuel sind. In einer örtlichen Kneipe diskutierte er mit einem meiner Doktoranden über das biblische Gebot zur Vernichtung der Kanaaniter. Für meinen Doktoranden bezogen sich diese Passagen auf historische Ereignisse, was sie für Hart eindeutig nicht taten; er verstand die Texte symbolisch.
Im Frühjahr 2015 ging ich nach England, um an der Birmingham University zu lehren, während David in St. Louis blieb. Wir setzten unsere Debatte über den Universalismus (mit zunehmender Vehemenz) per E-Mail fort. Ich bemerkte gegenüber dem östlich-orthodoxen Hart, dass die überwiegende Mehrheit (vielleicht 10 zu 1) der frühen christlichen Autoren – griechische, lateinische, syrische und koptische – keine Universalisten waren. In einer E-Mail antwortete David, dass ihm die Wahrheit selbst wichtiger sei als Präzedenzfälle oder Autoritäten (obwohl er meinte, dass zumindest einige Autoritäten seine Ansichten unterstützten). Wenn eine ewige Hölle ein notwendiger Bestandteil der christlichen Lehre wäre, fügte er hinzu, würde das für ihn bedeuten, dass das Christentum selbst offensichtlich falsch sei. Damals dämmerte mir bereits, was später zu einem der zentralen Argumente in That All Shall Be Saved werden sollte. Bibelexegese ist natürlich ein zentraler Aspekt der Universalismus-Debatte, und Harts The New Testament: A Translation (2017) ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Argumentation für den Universalismus, wie er in That All Shall Be Saved selbst darlegt.[1]
Im Folgenden werde ich Harts Rhetorik bzw. Argumentationsstil, seine Argumente bzw. den Gehalt seiner Argumentation sowie seine Exegese bzw. biblische Grundlage für seine Argumentation untersuchen. Am Ende werde ich mich mit der Frage befassen, wie man seine Eschatologie praktizieren bzw. ausleben kann.
Harts Rhetorik
Man kann Harts Argumente für den christlichen Universalismus nicht losgelöst vom Ethos und Pathos seiner Prosa betrachten. Willis Jenkins spricht von Harts „adjektivischer Gereiztheit“, während Douglas Farrow ihn als „intellektuellen Faustkämpfer“ bezeichnet, „der wie ein Schmetterling schwebt und wie eine Biene sticht“. Was auch immer man davon hält, Harts verbale Feuerwerke sind so offensichtlich wie eine Bombenexplosion in einem Lesesaal. In That All Shall Be Saved behauptet er, seine intellektuellen Gegner und ihre Ansichten seien „bösartig rachsüchtig“, „raffiniert boshaft“, „scheinlogisches Gerede“, „in sich völlig unglaubhaft“, „moralisch stumpfsinnig“, „demonstrativ absurd“, „extravagante Absurditäten“ und Ausdruck einer „berauschenden Atmosphäre sich erhärtenden Unsinns“.[2] Diese Liste ist keineswegs vollständig, es handelt sich lediglich um die ersten paar Beleidigungen (insgesamt enthält das Buch nicht weniger als 118 abwertende Bezeichnungen für seine Gegner, ihre theologischen Ansichten, ihren Gott und ihr Verständnis von der Hölle).
Farrow bezeichnet Harts Ausdrucksweise als die Art von „großmäuligem Gerede, das normalerweise dazu dient, das Aufsehen vor einem Kampf zu schüren“ und „den weltweiten Vorrat an Beleidigungen nahezu erschöpft“. Es fällt schwer, sich ein anderes theologisches Werk der Vergangenheit oder Gegenwart vorzustellen, das sein Gift so gezielt und konzentriert einsetzt. Der Schreckliche Pfeilgiftfrosch des kolumbianischen Regenwalds ist kaum größer als ein Zentimeter, enthält aber genug Gift, um zehn Menschen zu töten. Auch Harts Werk ist schmal – und tödlich. Ging es Hart beim Schreiben darum? War seine Absicht, seine Gegner zu beseitigen, anstatt sie zu widerlegen?
Die außergewöhnliche Flut an Herabwürdigungen in That All Shall Be Saved ist nicht unwichtig. Die Bedeutung liegt meiner Meinung nach jedoch nicht dort, wo Harts Fans und Anhänger sie vermuten würden. Es handelt sich nicht um einen Hinweis darauf, dass der Sieg des Universalismus unmittelbar bevorsteht. Hart bissige Beschimpfungen lenken die Aufmerksamkeit der Leser von seiner Argumentationslogik ab und auf das schillernde Geschimpfe selbst – und tragen somit nicht dazu bei, seine eigene Position zu stärken. Die überzogene Sprache ist ein Zeichen von Schwäche, nicht Stärke. Dieses Buch wirkt verzweifelt. Auf diesen Seiten scheint Hart ein in die Enge getriebener Mann zu sein – ein Literat und Wortschmied, der auf die einzige ihm vertraute Weise um sich schlägt. Wer sich seiner intellektuellen Position sicher und von seiner Argumentation überzeugt ist, muss nicht hundert (oder mehr) beleidigende Ausdrücke in seine Schrift einfließen lassen. Das tun Menschen, wenn sie spüren, dass sie kurz davorstehen, ihre Sache zu verlieren. Hart gibt das in seiner Einleitung selbst zu: „Ich weiß, dass ich vernünftigerweise nicht erwarten kann, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen“, aber „ich habe vor, es bis zum Ende durchzuziehen“.[3]
Diese Seiten strahlen eine Atmosphäre müder Resignation aus. Hart stellt sich selbst als einsamen Kämpfer für die Wahrheit des Universalismus dar – was kaum der Fall zu sein scheint, da viele der heutigen akademischen Theologen seine Ansichten teilen. Merkwürdig ist auch die völlige Abwesenheit von Freude in diesem Buch. Jemand, der wirklich davon überzeugt ist, dass am Ende alle gerettet werden (die fehlgeleiteten Calvinisten eingeschlossen!), sollte angesichts der Aussicht auf den Himmel für alle Freude und Frieden ausstrahlen. Wenn Harts Argumentation wirklich richtig ist, dann sollte er sich auf den Augenblick freuen, in dem sich seine Position – vor Gott und vor der ganzen Menschheit – als wahr erweisen wird. Aber dieses Buch strahlt so viel Bitterkeit und Groll aus, dass man sich fragt, ob der Autor von seinen eigenen Argumenten selbst überzeugt ist.
Ein Schlüssel zur tieferen Bedeutung von Harts Buch liegt in den extremen Alternativen, die er in seiner Schlussfolgerung aufzeigt: entweder Universalismus oder Unglaube. Im letzten Absatz schreibt er
„Ich wurde in den vergangenen Jahren mehr als einmal gefragt, ob es sich – wenn ich zu der Überzeugung käme, das Bekenntnis zum Christentum setze den Glauben an eine Hölle ewiger Qualen unumgänglich voraus – in meinen Augen um einen Beweis dafür handeln würde, dass das Christentum als offensichtlich moralisch stumpfsinniger und logisch inkohärenter Glaube abzulehnen sei. Die Antwort darauf lautet: Ja, das würde es.“[4]
In seiner grenzenlosen Wut gegen die historische christliche Lehre liest sich Harts Buch größtenteils wie ein „neues atheistisches“ Buch von Richard Dawkins oder Christopher Hitchens. Wie für die atheistischen Autoren gilt auch für Hart, dass der „Gott“, den die Kirche seit Jahrhunderten predigt und lehrt, „erfinderisch sadistisch“, „theatralisch grotesk“, ein „kaltblütiger Spielteufel“ und somit eine „monströse Gottheit“ ist.[5]
Tatsächlich könnte man That All Shall Be Saved als eine neuatheistische Polemik lesen – allerdings mit einem universalistischen Happy End, das der kosmischen Erzählung am Ende aufgespült wird, um der ansonsten zwingenden Schlussfolgerung zu entgehen, dass der christliche Gott nicht existiert. Das universalistische Eschaton ist Harts (wortwörtliches) deus ex machina, da die Welt, wie Hart sie heute sieht, kaum Anzeichen dafür bietet, dass es einen liebenden Gott gibt, der sich um uns kümmert. Hart steht mit dem Rücken zur Wand und kämpft verbissen, weil er einen letzten Widerstand leistet – er kämpft ein letztes Gefecht, wie er meint, für den christlichen Theismus (oder zumindest einen Glauben, der für ihn Sinn ergibt).
Harts Argumente
Welche Argumente zeichnen sich – nachdem sich der kämpferisch-rhetorische Rauch und Nebel verzogen haben – in Harts Buch ab?
That All Shall Be Saved enthält drei Hauptargumentationsstränge für den Universalismus, auf die ich mich als das „Argument des verantwortlichen Schöpfers“ (die göttliche Schöpfung selbst impliziert die universale Erlösung), das „Argument der Wahl des Guten“ (der Wille der Geschöpfe kann niemals vollständig oder endgültig die Güte Gottes ablehnen) und das „Argument der menschlichen Solidarität“ (alle Menschen bilden eine Einheit und müssen daher entweder gemeinsam gerettet werden oder gemeinsam verloren gehen).
1. Das Argument des verantwortlichen Schöpfers
Hart präsentierte sein erstes Argument erstmals 2015 öffentlich in einem Vortrag an der University of Notre Dame über „Gott, die Schöpfung und das Böse“. Im Wesentlichen argumentiert er, dass Gott von dem Moment an, in dem er die Welt erschuf, für alles Böse (sollte es im Kosmos als endgültiges Ergebnis bestehen bleiben) voll verantwortlich sei. „Eine allumfassende Erlösung“, schreibt Hart, „ist eine Annahme, die sich mehr oder weniger zwangsläufig aus jeder wirklich kohärenten Betrachtung dessen ergibt, was es bedeutet, Gott als den freien Schöpfer aller Dinge ex nihilo zu sehen“.[6]
Obwohl es „unzählige Formen ‚sekundärer Kausalität‘“ gibt, besteht Hart darauf, dass „keine davon das eine Ziel überschreiten oder umgehen kann, auf das die erste Ursache alle Dinge ausrichtet“.[7] Denn: „Da Gottes Schöpfungsakt frei ist …, sind alle kontingenten Ziele absichtsvoll in seiner Entscheidung enthalten.“[8] Hart fügt hinzu, dass „alle Ursachen logisch auf ihre erste Ursache zurückgeführt werden können. Dies ist nichts weiter als eine logische Binsenweisheit.“[9] Diese Behauptungen sind verblüffend, und es kommen einem mehrere entscheidende Einwände in den Sinn. Um jeden Zweifel an Harts Position auszuräumen, betrachte folgende Aussage: „Insofern wir überhaupt etwas frei wollen können, liegt das demnach genau daran, dass er [Gott] uns dazu veranlasst.“[10]
Wenn geschöpfliches Handeln immer „in seiner [Gottes] Entscheidung enthalten“ ist und Gott, während wir etwas tun, „uns dazu veranlasst“, könnten wir zu Recht fragen: Warum gibt es dann das Böse überhaupt? In seinem Erklärungsversuch, wie das Böse letztlich überwunden wird, schafft Hart ein neues (und vielleicht unüberwindbares) Problem hinsichtlich des Ursprungs des Bösen. Oder ist Harts Gott sowohl böse als auch gut – manchmal beabsichtigt und vollbringt er Gutes, manchmal beabsichtigt und vollbringt er Böses? Das mag nicht die Schlussfolgerung sein, die Hart sich wünscht, ist aber eine mögliche Implikation seiner Argumentation. Harts „Argument des verantwortlichen Schöpfers“ beweist zu viel (und widerlegt sich damit selbst), denn wenn Gott für eschatologisches Übel verantwortlich ist, warum dann nicht auch für historisches? Und wenn alle geschöpflichen Entscheidungen in göttlichen Entscheidungen aufgehen, dann wird Gott zum Urheber jeder bösen Tat (denn es gibt keinen anderen Urheber), und ein universalistisches Happy End würde Gott dann nicht von allem Bösen freisprechen, das auf dem vermeintlichen Weg zum Glück – dem universalistischen Eschaton – geschehen ist.
Harts Argument erinnert mich an eine schockierende Passage bei Martin Luther, in der er schrieb, dass die Kraft in der Hand eines Mörders, wenn er das Messer in sein Opfer stößt, ihm von Gott geschenkt wird. Harts Bejahung der übergeordneten göttlichen Wirkmacht ist ironisch, da sie ihn mit den strengsten Thomisten und den fanatischsten Calvinisten in eine Reihe stellt: Ohne es zu wissen, wird Hart hier zum „Advocatus Augustini“. (Vielleicht wäre jetzt eine Entschuldigung angebracht?) Darüber hinaus widerspricht That All Shall Be Saved Harts früherem Werk The Doors of the Sea, in dem er göttliche und geschöpfliche Kausalität voneinander unterschied, den Kosmos als von zerstörerischen Kräften brodelnd darstellte und bezweifelte, dass die gegenwärtige Erfahrung Beweise für einen liebenden Gott liefert. Dort lehnte Hart die Vorstellung ab, „dass jede endliche Kontingenz ausschließlich und eindeutig die Wirkung eines einzigen Willens ist, der durch alle Dinge wirkt“; stattdessen postulierte er „andere, sekundäre, untergeordnete, aber freie Akteure“.[11]
Hart ist von einem Gott, der (zwischen Schöpfung und Eschaton) vergleichsweise wenig tut, übergewechselt zu einem Gott, der alles tut – man fragt sich, ob der Autor zu einer festen Meinung gelangt ist.
2. Das Argument der Wahl des Guten
Der zweite Argumentationsstrang in Harts That All Shall be Saved – das „Argument der Wahl des Guten“ – ist die Kehrseite des „Arguments des verantwortlichen Schöpfers“.
Da der menschliche Wille „in seiner [Gottes] Entscheidung enthalten“ ist, folgt daraus auch, dass „das Böse … niemals die ursprüngliche oder finale Absicht des Willens bilden kann“ und „kein rationaler Wille jemals für immer in der Entscheidung für das Böse verhaftet sein könnte“.[12] „Eine ewige freie Ablehnung Gottes ist nicht nur unwahrscheinlich“, folgert Hart, „sondern auch eine logisch nicht haltbare Idee“.[13] Harts Argumentation scheint ein Versuch zu sein, die Universalismus-Debatte durch begriffliche Festlegungen zu gewinnen, nämlich indem er die Begriffe der Debatte so definiert, dass sich daraus zwangsläufig die von ihm befürwortete Schlussfolgerung ergibt.
Im Grunde behauptet Hart, dass „sündige“ Entscheidungen niemals „freie“ Entscheidungen sein können. Da es keine „freien, aber sündigen Entscheidungen“ gibt, sind alle von Menschen getroffenen sündigen Entscheidungen unfrei, weswegen Menschen nicht für sie verantwortlich sind. Aus Harts Begriffsdefinitionen könnte man ableiten, dass Menschen niemals für irgendetwas schuldig sein können. Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass am Ende alle gerettet werden, da es „Sünder“ im spezifischen Sinne von „Menschen, die sich frei und damit strafbar für das Böse entscheiden“, nicht gibt. Da es keine „Sünder“ gibt, gibt es auch nichts, wovon jemand gerettet werden müsste. Wie aber lässt sich dies mit der moralischen Handlungsfähigkeit und Verantwortung des Menschen vereinbaren? Farrow bemerkt, dass Harts „Mensch nicht so sehr Mensch als vielmehr ein kleiner Gott ist“. Farrow stellt seine eigene Ansicht der von Hart gegenüber: „Der Mensch ist ein Geschöpf, das erschaffen wurde, um Gott frei zu lieben. Er ist nicht nur eine andere Art, auf die Gott sich selbst liebt.“
3. Das Argument der menschlichen Solidarität
Harts dritter Versuch, die Erlösung aller zu beweisen – das „Argument der menschlichen Solidarität“ –, schneidet auch nicht besser ab. Dieses Argument basiert auf einer nicht-wörtlichen Deutung von Gottes Schöpfung der Menschheit in den Schriften des frühen Kirchenautors Gregor von Nyssa. Hart schreibt:
„Von Ewigkeit an, sagt Gregor, hat Gott die Menschheit in Form eines idealen ‚Menschenwesen‘ konzipiert …, ein Wesen, das ganz nach dem göttlichen Ebenbild geschaffen wurde, weder männlich noch weiblich, ausgestattet mit göttlichen Tugenden: Reinheit, Liebe, Impassibilität, Glückseligkeit, Weisheit, Freiheit und Unsterblichkeit.“[14]
Und weiter: „Dieses ursprüngliche ‚ideale‘ Menschenwesen umfasst – und ist in der Tat identisch mit – die gesamte pleroma [Fülle] aller Menschen aller Zeiten, vom ersten bis zum letzten.“[15] Da jeder Mensch, der jemals leben wird, Teil dieses „‚idealen‘ Menschenwesens“ ist, bedeutet dies, dass „entweder alle Menschen gerettet werden müssen oder keiner gerettet werden kann“.[16]
Der Leser mag sich den Kopf darüber zerbrechen, wer oder was dieses „ideale Menschenwesen“ ist, das „weder männlich noch weiblich“ ist? Die einzigen Menschen, die man in 1. Mose (oder anderswo in der Bibel) findet, sind einzelne Männer und Frauen, nicht ein zusammengesetzter, allumfassender Mega-Hominide, der männliche und weibliche Identitäten miteinander verbindet (wie in Platons Mythos des Androgynen). Bei allem Respekt für Gregor – einem wichtigen Architekten der Trinitätslehre – bleibt es dabei, dass sich seine Deutung der Schöpfungsgeschichte in die spekulative Ozonschicht griechischer Philosophie begibt und nicht vom biblischen Text geprägt ist. Für Gregor war der biblische „Adam“ kein individueller Mensch, sondern eine kollektive Menschheit (welche die jüdische Kabbala später Adam Kadmon nannte, einen mystischen „Baum der Seelen“, aus dem sich Individuen wie Zweige herauslösen). Für ihn schuf Gott die Menschheit, und die Menschheit muss gerettet werden. Der Universalismus ist Gregors Schöpfungsverständnis inhärent.
Man kann es sich so vorstellen: Wenn dein Laib Brot schimmelt, kannst du den verdorbenen Teil abschneiden und einen Teil retten; wenn dagegen deine Milch sauer wird, musst du sie komplett wegschütten. Für Hart ist die Menschheit nicht wie das schimmlige Brot, von dem man einen Teil retten kann, sondern wie die Milch, die entweder in Gänze genießbar oder verdorben ist. Beachte jedoch, wie sehr sich diese Lehre von der biblischen Vorstellungswelt unterscheidet, in der einzelne Menschen Gott begegnen und individuelle Entscheidungen treffen: zu glauben oder nicht zu glauben, zu rebellieren oder zu gehorchen.
Ein weiterer beunruhigender Aspekt von Harts Argumentation ist, dass er dem „universalen Menschenwesen“ eine quasi-göttliche „Impassiblität“ zuschreibt, was den Eindruck erweckt, er vertrete eine esoterische Vorstellung von Menschheit, die wir parodistisch wie folgt zusammenfassen könnten: „Am Anfang war die Menschheit, und die Menschheit war bei Gott, und die Menschheit war (fast) Gott.“ Eine derart spekulative Lehre ist weit entfernt von der Einfachheit des Evangeliums (vgl. 2Kor 11,3), und wir erinnern uns vielleicht an Farrows Bemerkung, dass Harts „Mensch nicht so sehr Mensch als vielmehr ein kleiner Gott ist“. Das Argument der „menschlichen Solidarität“ beweist nur eines: Wenn man von einer unbiblischen Deutung der Anfänge ausgeht (ursprüngliches Menschenwesen), kommt man zu einer unbiblischen Darstellung des Endes (universale Erlösung).
Unterzieht man sie einer kritischen Prüfung, zeigen die drei Hauptargumentationsstränge von Hart die Schwäche seiner Argumentation für den Universalismus.
Harts Exegese
Wie bereits erwähnt, ist Harts Übersetzung des Neuen Testaments Teil seines universalistischen Projekts. In einem Artikel in der New York Review of Books urteilte Garry Wills, dass Hart „sich bemüht, die Hölle aus dem Text der Bibel zu verbannen“, wofür er entsprechende Belege anführt. Anstatt das Feuer der Hölle als „ewig“ zu bezeichnen, übersetzt er aiōnios mit „des Zeitalters“ (aiōn) (vgl. Mt 18,8; 25,41). Unter Gelehrten herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass aiōnios gelegentlich „ein Zeitalter lang“ bedeutet, aber Harts Übersetzung ist in diesem Punkt hölzern und steif. Infolgedessen erweist sich die Übersetzung von aiōnios in nicht-Höllen-Kontexten oft als verwirrend.
Hier ist ein wohlbekannter Vers in Harts ungewohnter Fassung: „Denn also hat Gott denn Kosmos geliebt, dass er seinen Sohn gab, den einzigen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vergehen möge, sondern das Leben des Zeitalters habe“ (Joh 3,16; Hervorhebung hinzugefügt). Wie bitte? Schauen wir uns außerdem Harts Neuübersetzung der Verheißung an Jesus Christus – „Du bist Priester in Ewigkeit“ (Hebr 5,6; 7,17) – an: „Du bist Priester für das Zeitalter.“ Was soll das bedeuten? Dass der priesterliche Dienst Christi befristet ist? Wo Jesus die Verdammten von den Erlösten trennt (vgl. Mt 25,46), übersetzt Hart: „Diese werden in die Strafe des Zeitalters gehen, die Gerechten aber in das Leben des Zeitalters“. Harts Interpretation von aiōnios hat also ein verstecktes Preisschild: Nicht nur die Androhung von Strafe, sondern auch die Verheißung von Seligkeit könnte ein Ablaufdatum haben – beide sind „des Zeitalters“. Zumindest ist Hart konsequent: Der Himmel könnte genauso vergänglich sein wie die Hölle.
In Harts Übersetzung ist Gehenna nicht mehr „Hölle“, sondern „Hinnoms Tal des Feuers“ (Mt 5,22). In seinen warnenden Worten hinsichtlich Gehenna war Jesus also seltsamerweise auf eine bestimmte Müllhalde außerhalb Jerusalems fixiert. Ein nicht-irdischer oder transzendenter Ort der Bestrafung scheint durch die Wortwahl des Übersetzers ausgeschlossen zu sein. Proorizein – normalerweise „vorherbestimmen“ – übersetzt Hart mit „im Voraus markieren“ (Eph 1,5.11), vielleicht um die Konnotationen der gängigen Übersetzung zu vermeiden. Hart übersetzt diabolos nicht mit „der Teufel“, sondern mit „der Verleumder“, womit er die Rolle Satans enger fasst als das Neue Testament. Judas 6 verwendet ein eindeutiges Wort für unendliche Strafe (aidios), aber Hart – in einer ungewöhnlichen Passage, in der er sich mit dem Thema gefallener Engel befasst – merkt an, dass dieser Text sich auf Dämonen und nicht auf Menschen bezieht. Wir fragen also: Werden die gefallenen Engel für immer bestraft? Und wenn ja, was wird dann aus Harts Argument, dass kein einziges Geschöpf für immer bestraft werden kann? In einer Online-Antwort weist Hart Wills’ Andeutung zurück, dass es „ein gewisses Muster in diesen [Übersetzungs-]Entscheidungen“ gibt. Hart ist jedoch nicht der erste Autor, der etwas in seinen Texten übersieht, was seine Leser leicht erkennen können.
In That All Shall Be Saved umgeht Hart die Kraft biblischer Passagen, die seinen Universalismus untergraben, indem er argumentiert, dass keine der „eschatologischen Formulierungen des Neuen Testaments … als etwas anderes als eine intentionale heterogene Phantasmagorie verstanden werden sollte, deren Absicht ebenso sehr darin besteht, zu desorientieren wie zu belehren“. Er fügt hinzu: „Je genauer man sich die wilde Mischung von Bildern ansieht …, desto mehr löst sich das Bild in Evokation, Atmosphäre und Dichtung auf“.[17] Hier hebt sich Harts Argumentation selbst auf, denn wenn die biblischen Autoren nichts als evokative Phrasen und Symbolik bieten, dann kann weder der Universalist noch der Partikularist auf der Grundlage der Schrift irgendetwas Gesichertes über das Leben nach dem Tod behaupten. Um die universale Erlösung aufrechtzuerhalten, ist Hart bereit, nicht nur die endlose Dauer des Himmels (siehe oben) infrage zu stellen, sondern auch die Autorität der Schrift und den erkennbaren Inhalt der göttlichen Offenbarung.
Wie andere universalistische Exegeten hat auch Hart in seiner biblischen Sichtweise blinde Flecken. Wie andere Anhänger Origenes’ hält er an einem eher überredenden als zwingenden Modell für Gottes Überwindung des Bösen fest. Doch 2. Mose und Offenbarung zeigen, dass das Böse nicht immer auf sanfte Überredung reagiert, sondern manchmal durch überlegene Macht besiegt werden muss. Der Pharao wird letztlich nicht überredet, sondern durch die Macht Jahwes vernichtet. Auch dem Tier, dem Teufel und dem falschen Propheten wird das Böse nicht ausgeredet, sondern sie werden gefasst und in den Feuersee geworfen. In all diesen Fällen ist die Ausübung der Macht Gottes zur Überwindung des Bösen etwas Gutes und nicht etwas Böses. Die himmlischen Heiligen rufen „Halleluja!“, als der monströsen Bosheit Babylons endgültig und vollständig ein Ende bereitet wird (vgl. Offb 19,1–5).
Seine Eschatologie ausleben
Hart zeigt in seinen Schriften selten pastorales Gespür und Feingefühl. Seine Auffassung des Universalismus ist spekulativ, abstrakt und distanziert – die Art von Buch, das ein religiöser Intellektueller schreibt, ohne sich um die Auswirkungen auf Laienchristen oder das tagtägliche Leben zu kümmern. Im deutlichen Gegensatz dazu verbinden die biblischen Lehren zur Eschatologie Zukunftserwartungen mit missionarischer Dringlichkeit, geistlicher Ermahnung und Aufrufen zur Selbstverleugnung.
Als Jesus auf dem Ölberg sprach, verband er seine Endzeitrede mit einem Aufruf zur Wachsamkeit und einer Warnung vor dem bösen Knecht, der von der Rückkehr seines Herrn überrascht wurde (vgl. Mt 24,42–51). Matthäus 24 verbindet die Wiederkunft Jesu nicht nur mit dem Aufruf, sich moralisch und geistlich darauf vorzubereiten, sondern auch mit dem Thema der Evangelisation: „Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker, und dann wird das Ende kommen“ (V. 14). Ebenso betont das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen (vgl. Mt 25,1–13) die Notwendigkeit, auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet zu sein. Als die Apostel Jesus nach der Auferstehung fragen, ob er nun die Königsherrschaft Israels wiederherstellen werde, fordert er sie zur Evangelisation auf und verbindet damit erneut seine Wiederkunft mit der heutigen Mission der Kirche (vgl. Apg 1,6–8).
Die Offenbarung stellt Gottes Volk als die „Braut“ dar, die mit Christus als dem „Bräutigam“ vereint werden soll. „Seine Frau hat sich bereit gemacht“, heißt es dort: „Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen“ (Offb 19,7–8). Der 1. Johannesbrief verbindet die eschatologische Hoffnung mit geistlicher Reinigung: „Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleichwie auch Er rein ist“ (1Joh 3,2–3). Angesichts des bevorstehenden Endes der Welt ruft der 2. Petrusbrief aus: „Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt“ (2Petr 3,11–12). Und Paulus’ Brief an Titus verbindet unsere „glückselige Hoffnung“ (Tit 2,13) mit der Aufforderung, „besonnen und gerecht und gottesfürchtig [zu] leben in der jetzigen Weltzeit“ (2,12).
All diese Passagen legen nahe, dass es notwendig und angemessen ist, eschatologische Lehren im Hinblick auf ihre praktischen Auswirkungen zu bewerten. Es ist äußerst schwierig, sich vorzustellen, wie der biblische Aufruf zu Selbstverleugnung, gottgefälligem Leben und mühevoller Evangelisation auf der Grundlage einer universalistischen Theologie gedeihen kann. Wer müsste sich bemühen, wachsam oder vorbereitet zu sein, wenn die endgültige Erlösung aller bereits im Voraus klar wäre? Frühere christliche Universalisten (darunter auch Origenes selbst) erkannten das Problem und schlugen vor, den Universalismus vor den Massen geheim zu halten und nur unter wenigen reifen Gläubigen zu verbreiten. Hart scheint nicht zugeben zu wollen, dass es hier ein Problem gibt.
Selbst wenn der Universalismus biblisch begründet wäre (was er nicht ist), und selbst wenn fundierte theologische oder philosophische Argumente ihn glaubwürdig machen würden (was sie nicht tun), könnte der Universalismus dennoch nicht zur offiziellen, öffentlichen Lehre der christlichen Kirche werden, ohne ihre moralischen, geistlichen und missionarischen Grundlagen zu untergraben. Die Universalist Church – einst die sechstgrößte Konfession der USA und der einzige eindeutige historische Präzedenzfall, bei dem diese Lehre im großen Stil angenommen wurde – veranschaulicht diesen Punkt: Die Konfession schrumpfte, leugnete schließlich die Göttlichkeit Jesu, und schloss sich am Ende mit einer anderen schrumpfenden religiösen Organisation zur UU (Unitarian-Universalist Association) zusammen, die zu guter Letzt das Wort „Gott“ aus ihrer Lehrgrundlage entfernte, um aufrichtige Agnostiker, die ihr beitreten wollten, nicht zu verärgern. Denjenigen, die sich heute für den Universalismus in der Kirche starkmachen, sollte dieser historische Fall eine Warnung sein. Stell dir einen Bauern vor, der sein Feld von Schädlingen befreien will und deshalb eine Chemikalie versprüht (angeblich ein starkes und wirksames Pestizid) und innerhalb weniger Wochen feststellen muss, dass seine Pflanzen verdorren. Das ist Universalismus: Im Namen der Aktualisierung und Verbesserung der Lehre der Kirche tötet er, zusammen mit ihrer Lehre, die Kirche selbst.
Der Glaube an die universale Erlösung wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch in Zukunft (wie schon in der Vergangenheit) eine private Überzeugung bleiben, die von einer entwurzelten intellektuellen Elite gepflegt wird, und die eher am Rande als im Zentrum des kirchlichen Lebens ihr Dasein fristet. Der Großteil der Gläubigen wird diese Lehre nicht annehmen. Die Schafe Jesu kennen seine Stimme, und der Stimme eines Fremden werden sie nicht folgen (vgl. Joh 10,5.27). Wie bereits in der Vergangenheit wird sich der Universalismus auch in Zukunft als selbstzerstörerische, den Glauben unterminierende und die Kirche entkräftende Lehre erweisen. Universalisten sind eine theologische Spezies, die vom Aussterben bedroht ist.
Ein afroamerikanischer Spiritual aus dem 19. Jahrhundert vergleicht die christliche Erlösung mit einer Zugfahrt:
„The gospel train is coming; I hear it just at hand. I hear the car wheels moving, And rumbling thro’ the land. Get on board, children, For there’s room for many a more.“
„Der Gospelzug rollt heran; Ich hör’ ihn schon ganz nah. Ich hör’ die Wagenräder rollen, Und rumpeln durch’s Land. Steigt ein, Kinder, Denn es ist noch Platz für viele mehr.“
Eine Adaption aus dem 20. Jahrhundert erweitert die Zug-Analogie:
„When you get down to the station, And the train’s about to leave, You be sure to have a ticket, If you really do believe.“
„Wenn du zum Bahnhof kommst Und der Zug kurz vor der Abfahrt steht, Solltest du sicherstellen, dass du ein Ticket hast, Ob du auch wirklich glaubst.“
Also reich mir bitte die Gitarre, schnappt ihr euch das Banjo, den Tonnenbass, das Waschbrett, die Löffel, den Krug, die Fiedel, die Mundharmonika und das Kazoo – und wir starten unser Volksmusikfest. Aber es ist nicht Harts Gospelzug, der die Gläubigen zu den Himmelspforten bringen wird, sondern der Zug, für den du ein „Ticket“ brauchst, und bei dem es darauf ankommt, dass du „wirklich glaubst“.
1 Vgl. David Bentley Hart, That All Shall Be Saved: Heaven, Hell, and Universal Salvation, New Haven: Yale University Press, 2019, S. 3.
2 Ebd., S. 11, 12, 18, 18–19, 19.
3 Ebd., S. 4.
4 Ebd., S. 208.
5 Ebd., S. 23, 45–46, 167.
6 Ebd., S. 66–67.
7 Ebd., S. 69.
8 Ebd., S. 69–70.
9 Ebd., S. 70.
10 Ebd., S. 183.
11 David Bentley Hart, The Doors of the Sea: Where Was God in the Tsunami?, Grand Rapids: Eerdmans, 2005, S. 29–39; vgl. ebd., S. 89–91.
12 Hart, That All Shall Be Saved, S. 70, 175, 165.
13 Ebd., S. 178.
14 Ebd., S. 139.
15 Ebd.
16 Ebd., S. 155.
17 Ebd., S. 119.