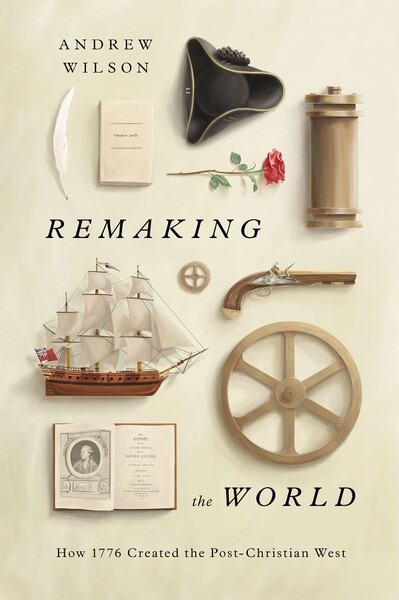
Remaking the World
In den letzten Jahren hat sich unter Christen die Überzeugung verstärkt, dass wir Zeugen eines tiefgreifenden kulturellen Wandels sind. Begriffe wie „post-christlich“, „expressiver Individualismus“ (Carl Trueman) oder „säkulares Zeitalter“ (Charles Taylor) prägen zunehmend die Analyse unserer Zeit. Nicht selten führt dies zu einer pessimistischen Grundstimmung – einem Gefühl, immer mehr ins Abseits zu geraten. Teil der Verunsicherung scheint eine allgemeine Geschichtslosigkeit zu sein. Hier setzt Remaking the World: How 1776 Created the Post-Christian West an. In diesem Buch bietet Andrew Wilson, Pastor der King’s Church London, eine Entstehungsgeschichte unserer Kultur.
Drei Gründe, das Buch zu lesen
Andrew Wilsons Buch überzeugt nicht nur durch seine zentrale These, sondern auch durch Stil, Substanz und Relevanz. Drei Aspekte stechen dabei besonders hervor:
- Die enthaltenen Geschichten sind schlichtweg hochinteressant. Man begegnet außergewöhnlichen Persönlichkeiten und Gruppen, erfährt von großartigen Erfindungen und spannenden Ideen. Beim Lesen fragt man sich immer wieder verblüfft: Das ist auch 1776 passiert?
- Wilsons Stil ist kurzweilig, clever und lädt nicht selten zum Schmunzeln ein. Seine sorgfältige Recherche merkt man dem Buch an.
- Christen sollen die Zeit und Kultur, in der sie leben, bestmöglich verstehen – nicht nur, um treu zu leben, sondern vor allem, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Genau auf dieses Ziel läuft das Buch erfreulicherweise hinaus.
Ein Schlüsseljahr
Die These des Werkes ist schnell formuliert: Das Jahr 1776 hat entscheidend dazu beigetragen, die Welt zu formen, in der wir heute leben. Wie in einem Brennglas sind in diesem Jahr sieben große Transformationen zu erkennen, die bis heute prägend sind: Globalisierung, die Aufklärung, die Industrielle Revolution, „The Great Enrichment“, die Amerikanische Revolution, der Beginn des Post-Christentums und die Anfänge der Romantik. Diese Entwicklungen „haben die Welt verändert und unsere Sicht auf Gott, das Leben, das Universum und alles andere nachhaltig geprägt“ (S. 7). Menschen im Westen unterscheiden sich von der Mehrheit aller anderen Menschen in Raum und Zeit, denn sie sind „WEIRDER“: western, educated, industrialized, rich, democratic, ex-Christian, romantic. Das Akronym WEIRD stammt aus der psychologischen Forschung, Wilson greift diese Gedanken auf und erweitert sie um zwei Kategorien. Die Stärke des Buches liegt mehr im Erzählen einzelner Geschichten und großer Entwicklungen als in einer Bewertung aus christlicher Perspektive – dies mag aber auch überhaupt nicht Wilsons Anspruch sein. Es gelingt ihm, komplexe Sachverhalte herunterzubrechen und dennoch nuanciert zu bleiben. Besonders hervorzuheben ist, dass das Christentum als Kraft innerhalb der Kultur verstanden wird. Der Autor erinnert daran, dass christliche und nicht- oder anti-christliche Ideen häufig zusammengewirkt haben. Dies gilt bis heute auf korporativer wie auf individueller Ebene: Nichtchristen haben viele christliche Prägungen; Christen haben viele nichtchristliche Prägungen.
Wie sehr unser Alltag von Dingen geformt ist, die 1776 ihren Anfang nahmen, zeigt Wilson im ersten Teil des Buches. Hier macht der Autor mehr als 100 Verallgemeinerungen über uns, die tatsächlich (fast) alle zutreffen: von „Du hast noch nie ein Tieropfer miterlebt“ über „Du trägst etwas aus Baumwolle“ zu „Du hast schon mindestens einen Persönlichkeitstest gemacht.“ Während einem als Leser viele der genannten Dinge selbstverständlich vorkommen, wird hier der Blick dafür geschärft, dass die Welt auch anders sein könnte.
Sieben große Umbrüche
Im Hauptteil des Buches beleuchtet Wilson nacheinander die sieben Transformationen, wobei er von der Reihenfolge des Akronyms abweicht, sodass sich die folgenden Kapitel ergeben.
- Becoming Western: Die maritimen Welterkundungen Cooks, die primär von Entdeckerlust motiviert waren, haben die Sicht der Welt derart verändert, dass der „Westen“ überhaupt erst entstanden ist. Die vorteilhafte Stellung des Westens führt Wilson vor allem auf eine Kombination von günstigen Voraussetzungen für die Landwirtschaft zurück.
- Becoming Democratic: Hier wird erzählt, wie es zur amerikanischen Unabhängigkeit kam. Von enormer Bedeutung ist, wie diese politische Umwälzung mit einer „dauerhaften Veränderung in der moralischen Vorstellungskraft WEIRDER Menschen“ einherging (S. 92). Zunächst im Kontext von staatsphilosophischen Diskussionen verortet, haben sich Konzepte wie Rechte, Wahlen oder Gleichberechtigung allmählich als Axiome etabliert, die nicht mehr hinterfragt werden können.
- Becoming Educated: Neben einigen Bemerkungen zum aufklärerischen Denken mit seiner optimistischen Sicht auf den menschlichen Verstand ist vor allem Wilsons Kritik an dem häufig (immer noch) verbreiteten Narrativ der Aufklärung von Interesse. Die Lichtmetaphorik (im englischen „Enlightenment“ noch deutlicher) half den Denkern, ihr eigenes Projekt gegen eine „finstere“ Epoche abzugrenzen und so den Fortschritt umso „heller“ erscheinen zu lassen. Dies ist allerdings aus zwei Gründen zu hinterfragen. Zum einen ist die Aufklärung nicht die einzige Zeit, in der es bedeutende Erfindungen und intellektuelle Aufbrüche gab. Ihr Anspruch auf eine exklusive Rolle als Höhepunkt der menschlichen Entwicklung wirkt überheblich und geschichtsvergessen. Zum anderen finden sich bei nicht wenigen zentralen Gestalten der Aufklärung problematische Überzeugungen bis hin zu abstoßenden Aussagen über Rasse und Menschenwürde, die sich auch nicht einfach mit einem Verweis auf die historische Situation wegerklären lassen.
- Becoming Ex-Christian: Hier öffnet Wilson ein Spektrum verschiedener Positionen, das von einer Überraschung darüber, dass das Christentum nunmehr lediglich eine Option unter vielen ist, bis hin zum offenen Gotteshass und einer radikalen Ablehnung christlicher Werte reicht. Die Grundidee ist jedoch, dass selbst die radikalsten Aufklärer in der Folge von Spinoza – wie Voltaire und Diderot – durch und durch vom Christentum geprägt sind. Ein anschauliches Beispiel bildet Franklins Änderung der Unabhängigkeitserklärung von „We hold these truths to be sacred and undeniable“ zu „We hold these truths to be self-evident“. Menschenrechte, Gleichheit, Freiheit scheinen selbstverständlich, weil die Kultur so christlich geprägt ist, doch ebendiese Grundlage soll ihnen nun entzogen werden. Wie es zu diesem „Ex-Christentum“ gekommen ist, schreibt Wilson einer Mischung aus Heidentum und Protestantismus zu: „Das Heidentum, das das Heilige innerweltlich und das Letztgültige innerhalb von Raum und Zeit verortet, trat in Reaktion mit den Spaltungen und Zweifeln, die der Protestantismus mit sich brachte, woraus ein neues Gebilde entstand“ (S. 156). Diese recht kritische Sicht auf den Protestantismus ist durchaus bedenkenswert, historisch jedoch schwer einzuholen.
- Becoming Industrialized: Verschiedene wissenschaftliche Entwicklungen und praktische Erfindungen – allen voran Watts Dampfmaschine – machen 1776 zu einem zentralen Jahr der Industriellen Revolution. Hier wird deutlich, dass es in der Geschichte nicht nur um Ideen geht, sondern dass auch materielle Veränderungen von großer Bedeutung sind.
- Becoming Romantic: Auch wenn die Epoche der Romantik häufig erst später angesetzt wird, bringt der Autor gute Punkte, ihre Anfänge bereits um 1776 zu sehen – nicht zuletzt, weil die Strömung des Sturm und Drang als ein Vorläufer und Wegbereiter verstanden wird. Die sieben Stichworte inwardness, infinity, imagination, individuality, inspiration, intensity, innocence, ineffability – eines der vielen Beispiele für Wilsons Vorliebe für Alliterationen – helfen ihm, verschiedene Dichter und Denker als romantisch einzuordnen. Einige Aussagen von Rousseau lesen sich beispielsweise wie aus einem Disney-Film: „Sei deinem eigenen Herzen treu“, „Ich will wissen, wer ich bin, also schaue ich nach innen.“ Wilson zeigt auf, wie die Empfindungen und Überzeugungen, die dem fundamentalen Glaubenssatz entspringen, dass das innere Selbst grundlegend gut ist, einen tiefgreifenden Wandel hervorgerufen haben. Das innere Leben, die ‚Identität‘ wird zum Gegenstand tiefster Reflexion, nicht selten gepaart mit einem Umbruch der Sexualmoral. Denn auch die sexuelle Revolution lässt Wilson Ende des 18. Jahrhunderts beginnen, weil hier die Eliten offen in sexueller Unmoral leben, was medial verarbeitet wird und schließlich langsam nach „unten“ gelangt. In einer seltenen pastoralen Passage in diesem Teil des Buches wird die Anfrage laut: Was ist, wenn mein Herz, dem ich folgen soll, mich zu Zerstörung und Bösartigkeit führt?
- Becoming Rich: Ende des 18. Jahrhunderts hat die Menschheit das erste Mal den Punkt überschritten, wo Wohlstand ständig weiterwächst, statt in Wellen wieder abzuflachen. Dieses anhaltende Wirtschaftswachstum wird in der ökonomischen Forschung auch als „The Great Enrichment“ bezeichnet und auf verschiedene institutionelle, politische, soziale, kulturelle und geographische Faktoren zurückgeführt. Leider liefert Wilson nur knapp Anregungen aus christlicher Perspektive und gibt zu denken, dass die Gier der Menschen und die Anbetung des Mammons – auch derer, die sich Christen nennen – sowohl Wegbereiter als auch Folge dieser ökonomischen Entwicklung sind.
Die Ausführungen zu den beiden Aspekten Ex-Christian und Romantic scheinen besonders instruktiv, was vielleicht daran liegen mag, dass Wilson diese dem Akronym selbst hinzugefügt hat. Auch befassen sie sich weniger mit den ökonomischen, politischen und sozialen Umständen, sondern setzen sich eher mit den Ideen und Idealen auseinander, die uns antreiben. Dadurch bieten sie gerade aus theologischer Sicht viele Denkanstöße. Über ein rein historisches Interesse hinaus wird Wilsons Buch durch den abschließenden Teil besonders wertvoll, in dem er als Pastor Impulse gibt, wie die Kirche in der WEIRDER-Welt nicht nur überleben, sondern sich entfalten kann.
Drei Stichwörter für heute
Dabei beschreibt er zuerst, wie Christen 1776 gefühlt, gelebt und gedacht haben. Hierbei stehen die Stichwörter Gnade, Freiheit und Wahrheit im Mittelpunkt. In theologischen Traktaten, Streitigkeiten, Gedichten und Predigten war Gnade ein ständiges Thema – und ist es in weiten Teilen der christlichen Welt bis heute geblieben. Auch der Kampf gegen die Sklaverei und das Ringen um Religionsfreiheit beschäftigen viele prominente Christen um das Jahr 1776. In diesen beiden Punkten ist Wilsons Blick stark auf die anglophone Welt auf beiden Seiten des Atlantiks gerichtet. Für den dritten Aspekt, Wahrheit, wendet er sich an den deutschen Philosophen Johann Georg Hamann. Sichtlich begeistert gibt er einige Grundzüge seiner frühen, scharfsinnigen und theologisch fundierten Kritik an der Aufklärung, die sich vor allem auf eine unsachgemäße Trennung von Vernunft und Glauben bezieht, wieder.
Wilson nennt diese außergewöhnlichen Denker, Liederdichter, Freiheitskämpfer und Theologen, weil sie zeigen, wie Christen in der aufkommenden WEIRDER-Welt reagiert haben. Persönliche Bekehrungserlebnisse und Erfahrungen von Gottes Gnade sprechen Menschen im Zeitalter der Industrialisierung und Romantik besonders an. In einer immer westlicheren, reicheren und demokratischeren Welt haben Aufrufe zu persönlicher Religion und Religionsfreiheit eine immer stärkere Anziehungskraft. Und Hamanns Eintreten für die (christliche) Wahrheit spiegelt eine bewusste und überzeugte Antwort auf die Herausforderung einer ex-christlichen Kultur wider.
Diese Paradigmen wendet Wilson schließlich auf unsere Zeit an und fragt danach, wie die Kirche die Menschen in einer WEIRDER-Welt erreichen kann. Gnade, Freiheit und Wahrheit sind unsere evangelistische Chance und Herausforderung.
- WEIRDER-Menschen sehnen sich nach Gnade. In unserer Welt muss jeder seine Identität konstruieren, ist jeder verantwortlich dafür, seine Privilegien in angemessener Weise einzusetzen, und steht unter dem Druck, ständig seinen Status zu sichern. Was könnte schöner in den Ohren eines so angestrengten Menschen klingen als Paulus’ befreiender Satz: „Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin“ (1Kor 15,10)?
- WEIRDER-Menschen haben ein großes Anliegen für Freiheit. Ihr Auge ist geschärft für Ungerechtigkeit, Benachteiligung und Unterdrückung, aber dass die Unfreiheit bis in unser eigenes Inneres hineinreicht, dafür ist die Welt blind. Doch „jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde“ (Joh 8,34). Nur Christen haben eine Botschaft, die sowohl äußerliche als auch innerliche Ketten sprengen kann: „Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei“ (Joh 8,36).
- WEIRDER-Menschen suchen Orientierung. Postfaktizität ist keine tragfähige Lebensgrundlage — Jesus hingegen schon. Er sagt: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 14,6).
Wilsons Vision für ein blühendes christliches Leben inmitten einer WEIRDER-Welt ist so schlicht wie wunderschön:
„Treue ist wichtiger als Neuerungen. Der Verlust von Einfluss ist kein Grund zur Panik. Die Lehren, Erfahrungen und Praktiken, die die Kirche heute braucht, sind weitgehend die gleichen wie die, die sie im 18. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert und im 2. Jahrhundert brauchte. Wir sind verantwortlich für Gehorsam, nicht für Ergebnisse. Für Treue, nicht für Früchte. Wir mögen nicht mehr die gewohnten Auswirkungen sehen – von unserem Beten, Gottesdienst feiern, Bibel lesen, den Armen dienen, das Evangelium verkünden, die Sakramente teilen, einander lieben. Aber wir machen dennoch damit weiter und leben im Glauben, nicht im Schauen.“ (S. 290)
Buch
Andrew Wilson, Remaking the World: How 1776 Created the Post-Christian West, Wheaton: Crossway, 2023, 384 Seiten, ca. 24 EUR.