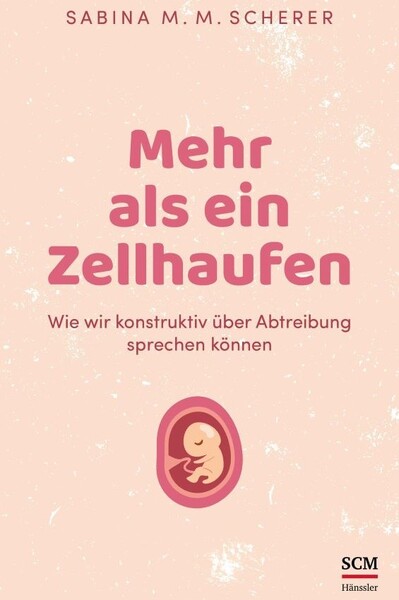
Mehr als ein Zellhaufen
Mit dem Abschlussbericht der von der Bundesregierung eingesetzten Kommission „Reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ ist die Debatte um das Thema Abtreibung wieder hochaktuell und medial präsent. Das Buch von Sabina M.M. Scherer erscheint daher zur rechten Zeit. Es bietet dem Leser eine strukturierte Übersicht über populäre Positionen und Argumente in dieser oft hochemotionalen Auseinandersetzung. Die Autorin spannt einen weiten Bogen und behandelt ein breites Spektrum an Themen, die in dieser Debatte eine Rolle spielen.
Sprachfähigkeit in der Abtreibungsdebatte erlangen
Dem Leser die verschiedenen Standpunkte und Argumente der Debatte näherzubringen und diese aus der Perspektive des Lebensschutzes zu beurteilen, ist das Hauptanliegen des Buches. Scherer greift dazu gängige Einwände gegen ihre Position auf und legt dann in sachlicher Weise dar, warum diese aus ihrer Sicht nicht zu überzeugen vermögen oder teilweise schlicht auf unzulässigen Verallgemeinerungen oder falschen Unterstellungen beruhen. Dabei wird schnell deutlich, dass Scherer durch ihre Online-Präsenz (z.B. durch einen eigenen Podcast und ihre Beiträge auf sozialen Medien) viel praktisches Wissen im Dialog mit Andersdenkenden vorweisen kann. Sie vermittelt dem Leser dadurch hilfreiche Tipps für eine konstruktive Gesprächsführung. Die einzelnen Unterkapitel werden meist mit einem kurzen zusammenfassenden Statement und Fragen zur eigenen Reflexion abgeschlossen.
Auswahl und Bewertung der Argumente
Wie bereits erwähnt, nimmt die Erwiderung auf Argumente der Gegenseite den größten Raum im Buch ein. Scherer überschreibt diesen Teil mit „Die wichtigsten Argumente in der Abtreibungsdebatte“ (S. 19–173). Da hier meiner Einschätzung nach auch einige „Scheinargumente“ aufgeführt werden (z.B. „No uterus, no opinion“ oder „Ich hoffe, ihr lebt alle vegan“), würde ich die Auswahl eher mit „populäre Argumente“ umschreiben. Aufgrund des Umfangs, den Scherer dadurch behandelt, werden einige tatsächlich starke Argumente der Gegenseite meiner Einschätzung nach nicht immer in ausreichender Tiefe dargestellt und überzeugend entkräftet. Die philosophisch relevanten Argumente sind teilweise sehr komplex und beinhalten subtile, aber relevante Differenzierungen. Hier wäre es meiner Meinung nach hilfreich gewesen, die unsachlichen Einwände eher kürzer zu behandeln und den Fokus auf die wirklich entscheidenden Gegenargumente zu legen.
Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Scherer bespricht auch die sogenannte „Geiger-Analogie“ der MIT-Philosophin Judith Jarvis Thomson.[1] Diese Analogie gilt als eines der prägendsten Gedankenexperimente in der neueren Philosophiegeschichte. Scherer schreibt dazu:
„Ein prominentes Gedankenexperiment stammt von der amerikanischen Philosophin Judith Jarvis Thomson: Die Geiger-Analogie, die aufzuzeigen versucht, dass körperliche Autonomie unabhängig vom Lebensrecht einer gleichwertigen Person Vorrang hat. In aller Kürze geht es darum, dass man eines Morgens aufwacht und feststellt, dass ein weltberühmter Geiger an den eigenen Körper angeschlossen wurde, weil er unter einer schweren Krankheit leidet und nur der eigene Körper als vorübergehende Rettung fungieren kann. Sollte man dazu verpflichtet sein, den Geiger weiterhin mithilfe seines Körpers am Leben zu erhalten?“ (S. 52)
Zur Verteidigung Scherers möchte ich hier anfügen, dass sich diese mutmaßliche Auffassung von Thomsons Sichtweise (körperliche Autonomie hat Vorrang gegenüber dem Lebensrecht einer anderen Person) selbst in einigen Darstellungen von Befürwortern eines Rechts auf Abtreibung findet. Thomson macht jedoch bereits in ihrem Aufsatz klar, dass ihr Argument ein anderes ist:
„Ich argumentiere nur, dass ein Recht auf Leben weder ein Recht auf die Nutzung des Körpers einer anderen Person noch ein Recht auf die Erlaubnis zur anhaltenden Nutzung des Körpers dieser Person garantiert – selbst wenn man ihn für den Erhalt des eigenen Lebens braucht. Das Recht auf Leben wird den Gegnern des Rechts auf einen Schwangerschaftsabbruch somit nicht auf die sehr einfache und klare Weise helfen, wie sie es möglicherweise gedacht haben.“[2]
Thomsons These ist somit nicht, dass körperliche Autonomie bei einem tatsächlichen Konflikt mit dem Lebensrecht Vorrang hat. Ihr Punkt ist, dass ihrer Auffassung nach das Recht auf Leben grundsätzlich nicht das Recht zur Nutzung des Körpers eines anderen Menschen beinhaltet und daher der Entzug des Körpers das Lebensrecht einer anderen Person gar nicht erst tangiert bzw. verletzt. Dies ist ein feiner aber entscheidender Unterschied, den es meiner Einschätzung nach zu beachten gilt, wenn man das Argument von Thomson effektiv kritisieren bzw. entkräften möchte.
Scherer führt dann vier oft genannte Einwände gegen Thomsons Argument ins Feld, die allesamt die Zulässigkeit der Analogie zu einer Abtreibung infrage stellen. Erstens, dass bei einer Abtreibung im Gegensatz zur Abtrennung vom erkrankten Geiger eine direkte und beabsichtigte Tötung vorliegt. Zweitens, dass der ungeborene Mensch im Gegensatz zum Geiger mit akutem Nierenversagen nicht an einer Krankheit leidet, aufgrund der er versterben wird. Drittens, dass es zwischen Mutter und eigenem (genetisch verwandtem) Kind eine natürliche verbindliche Fürsorgepflicht gibt und viertens, dass die Eltern schlussendlich in der Regel durch einvernehmlichen informierten Geschlechtsverkehr für die Existenz des von ihnen abhängigen Menschen verantwortlich sind.
Für nahezu alle Abtreibungen sind diese Unterschiede sicher zutreffend, wobei selbst dann noch geklärt werden muss, ob diese alle auch moralisch relevant sind. Das Kernproblem ist aber meines Erachtens Folgendes: Selbst wenn man alle diese Einwände akzeptiert, lassen sich immer noch Fälle einer Schwangerschaft konstruieren, die in allen moralisch relevanten Bereichen mit der Geiger-Analogie identisch sind und somit alle diese Einwände umgehen. Wenn man jedoch auch in diesen Fällen bzw. ohne Lebensgefahr für die Mutter eine „vorzeitige Beendigung“ der Schwangerschaft für unzulässig hält, dann muss der Fehler im Argument von Thomson woanders liegen und die Unzulässigkeit der vorzeitigen Beendigung einer Schwangerschaft anders begründet werden.
Die geäußerten Bedenken sollen jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass man dieses Buch nicht mit Gewinn lesen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Auf die Stärken komme ich daher gleich ebenso noch zu sprechen. Man sollte jedoch beachten, dass die philosophischen Argumente – z.B. die Frage, wodurch sich Personsein konstituiert, oder jene nach Tierrechten und gar nach der Moralbegründung – hier teilweise sehr verkürzt behandelt werden und damit einige meiner Ansicht nach wichtige Aspekte unberücksichtigt bleiben. Für die Auseinandersetzung mit gut informierten Kritikern und für eine moralphilosophische Begründung des uneingeschränkten Lebensschutzes für alle Menschen möchte ich daher empfehlen, sich etwas tiefer in die Materie einzuarbeiten.
Hilfestellungen für konstruktive Gespräche mit Andersdenkenden
Der Fokus des Buches liegt immer darauf, dem Leser konkrete Hilfen für eine konstruktive und gewinnende Gesprächsführung an die Hand zu geben. Dieses Versprechen im Titel löst das Buch vollumfänglich ein. Eine Übersicht wichtiger Gesprächsführungsprinzipien wird bspw. auf den Seiten 194 und 195 sowie im letzten Kapitel aufgeführt und erläutert. Ansonsten regt das Buch auch zur Reflexion des eigenen Standpunktes an. Man merkt, dass es der Autorin ein großes Anliegen ist, die oft vorhandene Schärfe und Emotionalität in der Auseinandersetzung mit diesem Thema sowie Stereotype und Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen. Ein wichtiger Baustein hierzu ist auch das Kapitel „Weniger hilfreiche Argumente“, in dem die Autorin Beispiele für Äußerungen „aus dem eigenen Lager“ anführt, welche für die Diskussion mit Andersdenkenden kontraproduktiv oder im besten Fall wirkungslos sind. Sie führt dort etwa die Berufung auf Einzelfälle an („Ich kenne eine Frau, die …“), die zwar gehört werden sollten, aber eben für die gesellschaftliche Debatte keine ausschlaggebende Rolle spielen. Positiv hervorzuheben ist ebenso, dass die Autorin mit möglichst wenig weltanschaulichen Vorannahmen argumentiert. Ich stimme Scherer darin zu, dass die Weltanschauung für die moralische Bewertung der Abtreibungsfrage zumindest in epistemischer Hinsicht nicht entscheidend ist. Man muss bspw. keine spezifisch theistische oder gar christliche Weltanschauung voraussetzen, um überzeugend für das Lebensrecht ungeborener Menschen argumentieren zu können – ebenso wie auch die Unzulässigkeit von Sklaverei Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen offenkundig einleuchtet.
Fazit
Das Buch von Sabina Scherer ist ein konsequent praxisorientierter Beitrag zur Debatte um den Schwangerschaftsabbruch und kann hier auf ganzer Linie überzeugen. Ihre Einwände gegen die ausgefeilten philosophischen Argumente für ein Recht auf Abtreibung sind meiner Einschätzung nach jedoch nicht immer folgerichtig und stehen teilweise auch in Spannung zur mutmaßlich eigenen Überzeugung. Vielleicht ist es beabsichtigt, aber an einigen Stellen hätte ich mir von der Autorin auch eine klarere eigene Positionierung gewünscht. Scherer lässt bspw. die Frage offen, ob zur Wahrung der Würde einer Frau nach einer Vergewaltigung eine Abtreibung als Option bestehen sollte. In Anbetracht der ansonsten im Buch vorgetragenen Argumentation dürfte dies jedoch kaum zu rechtfertigen sein.
In den meisten Gesprächen werden die von mir geäußerten Bedenken jedoch vermutlich nicht zum Tragen kommen und daher kann ich diesem Werk nur eine weite Verbreitung wünschen. Außer dem Buch Genug geschwiegen! Schwierigen Abtreibungsfragen selbstsicher begegnen ist mir jedenfalls keine Publikation im deutschsprachigen Raum bekannt, welche vor allem junge Menschen in einer leicht verständlichen Sprache einen Leitfaden für einen wertschätzenden und konstruktiven Dialog in der Abtreibungsfrage an die Hand geben möchte.[3] Wer sich daher in dieser Weise in den Diskurs einbringen möchte, findet hier sehr empfehlenswerte Hilfestellungen.
Buch
Sabina M.M. Scherer, Mehr als ein Zellhaufen: Wie wir konstruktiv über Abtreibung sprechen können, Holzgerlingen: SCM Hänssler, 2024, 224 Seiten, 20,00 EUR.
1 Judith Jarvis Thomson, „A Defense of Abortion“, in: Philosophy & Public Affairs 1 (1971), S. 47–66, hier S. 65. Online: https://spot.colorado.edu/~heathwoo/Phil160,Fall02/thomson.htm (Stand: 24.03.2025).
2 Ebd., S. 56.
3 Justina van Manen, Genug geschwiegen!: Schwierigen Abtreibungsfragen selbstsicher begegnen, Aachen: Bernardus Verlag, 2022.