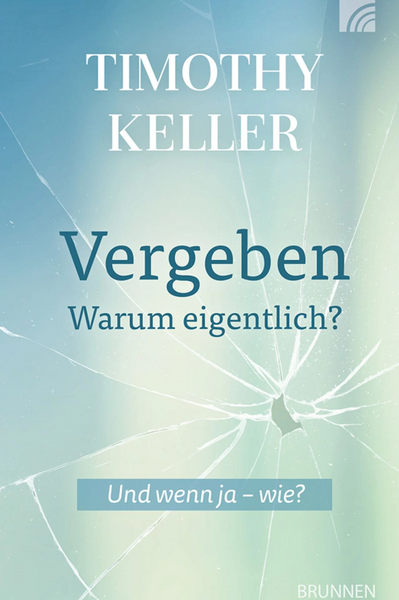
Vergeben – Warum eigentlich?
Vergeben – hat das etwas mit mir zu tun? Oh ja, sofort fallen mir sämtliche Verletzungen nach dem Tod meines ersten Mannes ein, unfassbar schmerzhafte und weitreichende Verletzungen. Ohne Vergebung bliebe nur Bitterkeit.
Und dann erinnere ich mich an die Wohngemeinschaft für hilfesuchende Personen, die wir damals leiteten, an den Kampf rund um „Kann oder muss ich bei Gott und Menschen überhaupt um Vergebung bitten?“ oder „Wie kann ich meinen Schuldigern vergeben?“. Diese Auseinandersetzungen waren die heftigsten Blockaden, Diskussionen und Entscheidungsmomente, denn hier lag zumeist der wesentliche Wendepunkt, ob jemand seinem Leben eine zweite Chance geben wollte und Gott vertraute, oder ob diese Person wieder zurück ins alte Chaos ging. „Vergeben“ ist garantiert das zentrale Thema, um als Mensch in der Spannung zwischen Gut und Böse überhaupt leben zu können und um die Tiefe des Daseins zu entdecken. Daher kann es kaum treffender sein, dass der Autor und Theologe Timothy Keller (1950–2023) wenige Monate vor seinem Tod das Buch Vergeben – Warum eigentlich? Und wenn ja – wie? mit einer Widmung für zwei seiner Freunde herausgeben ließ. Hier bringt er auf den Punkt, mit welchem Vorzeichen der Mensch im Leben atmen und schließlich in Frieden sterben kann.
Vergeben ist erwünscht, aber kontrovers diskutiert
Kann das Zerschlagene im Leben (wie das eisblaue zerbrochene Glas auf dem Buchcover) wieder heil werden? Timothy Keller beginnt mit einer offensiven Debatte, indem er den Umgang mit der Apartheid in Südafrika, mit Rassismus, Amokläufen und Missbrauchsskandalen offenlegt und den „übersteigerten Gerechtigkeitssinn“ unserer Kultur beschreibt.
Ist es bei diesen grausamen Straftaten nicht plausibel, dass Vergebung mit gutem Recht verweigert wird, auch um Täter zur Rechenschaft zu ziehen? Sind die Forderungen von Christen nach Vergebung nicht zu einfach, oberflächlich oder gar arrogant und letztendlich indirekt eine belastende Opferbeschuldigung, wenn diese nicht vergeben wollen? Ist ein Festhalten an Rache eher befreiend oder ist Rache ein selbst gezimmertes Gefängnis?
Es fällt auf, dass diese Kontroverse aufgrund der erlebten Verletzungen und der unterschiedlichen Vorstellungen von Vergebung emotional sehr hochgehalten wird, obwohl der Mensch ein grundsätzliches Bedürfnis nach Vergeben und Vergebung empfangen hat. Daher begründet Keller mit vielen historischen, philosophischen und biblischen Beispielen und Gedankengängen den einzigen heilenden und versöhnenden Ansatz, der als echte Vergebung sowohl die vertikale als auch die horizontale Ebene im Blick hat. So ist aufgrund einer veränderten Motivation die ersehnte Vergebung gekoppelt mit Gerechtigkeit möglich, vor allem auch im Umgang mit der eigenen Unzulänglichkeit und Schuld.
Was Vergeben nicht ist
Keller zeigt in den ersten drei Kapiteln auf, dass die am häufigsten vertretenen Ansätze von Vergeben und Vergebung nichts mit wirklicher Vergebung zu tun haben:
- Billige Gnade: Bedingungslos vergeben
- Ein bisschen Gnade: Vergeben als Transaktion (verdiente Vergebung)
- Keine Gnade: Überhaupt nicht vergeben
Der Blick nach innen hat in der heutigen therapeutischen Kultur die Betonung auf das Individuum fokussiert. Vergeben ist, wie in der Vergangenheit, nur aus egoistischen Motiven vertretbar, sodass eine Kultur mit zerbrochenen Beziehungen entstanden ist. Das kann nicht heilendes Vergeben sein. Richtiges Vergeben scheint aber notwendig, denn viel zu schnell behält der Täter das Opfer durch das Festhalten an Vergeltung gedanklich im Griff, und gleichzeitig blockiert ein Nicht-Vergeben die Wirkung des Evangeliums im Leben.
Was Vergeben ist
Keller macht in Kapitel 4 einen Streifzug durch die gesamte Bibel, zeigt auf, wie Vergeben durchgehend thematisiert wird und ein ehrfurchtsvolles Staunen vor Gott bewirkt. Er kommt zu folgendem Ergebnis: Vergeben ist teure Gnade im Gegensatz zu den o.g. allgemein verbreiteten Ansätzen. Es geht nicht um eine einfache Entschuldigung, die man manchmal sogar Gott gegenüber leichtfertig über die Lippen bringt. Stattdessen sind wir herausgefordert, wie im Gleichnis des ungerechten Knechts (vgl. Mt 18,21–35) die eigene Schuld ohne Verharmlosung, Schuldverschiebung, Selbstmitleid oder Selbstgerechtigkeit (Kap. 9) zuzugeben, Vergebung anzunehmen und sich dann wie der König zu verhalten, der gerne vergibt.
Dabei entsteht die Dynamik der Vergebung dadurch, dass nur der vergeben kann, der selbst Vergebung und Barmherzigkeit erlebt hat. Denn Christus hat am Kreuz sowohl der Gerechtigkeit/dem Zorn Gottes als auch der Liebe Gottes Genüge getan: „Im Kreuz lodern nun Gottes Zorn und seine Liebe für Sie und nicht gegen Sie“ (S. 121). In vier Schritten kommt es gekoppelt mit den geistlichen Ressourcen „Demut“ und „Freude“ und durch die reiche „kostspielige Liebe Christi“ zur echten Vergebung:
- Die Wahrheit sagen
- Mitleid/Verständnis aufbringen
- Schulderlass/Verlust auf sich nehmen, statt den anderen leiden zu lassen
- Freilassen/Wiederherstellung der Beziehung
Reue ist dabei das Bindeglied, um selbst nicht an der Unversöhnlichkeit zugrunde zu gehen.
Bei Jesus geht es nicht um eine Bühne für die eigene Ehre, für die Selbstverwirklichung oder Rache, sondern um einen würdevollen und wenn möglich versöhnenden Umgang auch mit dem Täter. Es geht um das Gewinnen der Beziehung, verbunden mit der gerechten Klärung der Situation.
Vergeben ist praktisch und versöhnend
Keller wird ab Kapitel 6 praktisch, indem er zwei Grundgedanken zusammenfügt: Zum einen wird in Markus 11,25 gefordert, mit einer vergebenden Grundhaltung zuerst zu vergeben, wenn der Missstand bewusst wird (z.B. beim Beten), denn schließlich ist man selbst immer von Gottes Vergebung abhängig (Kap. 8–9). Nur so kann man vor Rachewahn, Groll und Zorn bewahrt werden. Zum anderen nennt Keller den Aspekt aus Lukas 17,3b: Bei Vergehen muss der Verursacher grundsätzlich auf seine Tat angesprochen werden (z.B. wie es Rachael Denhollander als Missbrauchsopfer schrittweise erklärt, S. 133 ff.). Schuld ist ernst zu nehmen und darf nicht einfach gedankenlos ignoriert, verharmlost oder ausgehalten werden. Schuld kann nur durch echte Vergebung bewältigt werden. Zu diesem Willensakt gehört die Konfrontation, die auch eine angemessene Versöhnung im Blick hat, wenn der Täter sein Fehlverhalten anerkennt. Mit täglichen Übungen, Gebet für den Schuldigen und möglichen Zuwendungen trotz allem kann das Ziel (das Gewinnen oder Erhalten der Beziehung zum Wohl des Nächsten) erreicht werden. Es geht beim Vergeben nie darum, dem Täter einen Freibrief zum weiteren Verletzen zu geben, wie es fälschlicherweise oft aus der Bergpredigt hergeleitet wird, sondern die Bosheit ist grundsätzlich zu benennen, zu klären und auch zu begrenzen mit dem Ausblick, die Beziehung ggf. zu gewinnen. Bei fehlender Reue gilt es dann, als Opfer die Vergeltung oder Rache nicht selbst zu bewirken, sondern Gott zu überlassen (Kap. 10–11). Es bleibt die Herausforderung, dass „wir dringend lernen müssen, jeden Tag Vergebung im Kleinen zu üben. Wir sind überschwemmt von Kränkungen, Enttäuschungen und unbeabsichtigten Verletzungen, ganz zu schweigen von den vielen kleinen Akten von Unrecht, die Menschen jeden Tag bewusst gegen uns begehen. Niemand kann leben, wenn er nicht lernt, wann er im Stillen verzeihen sollte, wann er die Angelegenheit zur Sprache bringen sollte und wie er verzeihen kann, auch wenn die andere Person nicht bereit ist, ihre Schuld zuzugeben. Ohne Vergebung können wir nicht lieben, aber wir können auch nicht ohne sie leben“ (S. 62 f.).
Fazit
Tim Kellers Buch ist gerade für diejenigen eine Bereicherung, die meinen, sie hätten schon alles rund um das Thema Vergeben im Griff. Zu sehr wird in diesem Buch deutlich, dass das Evangelium nur verstanden werden kann, wenn begriffen wird, dass man selbst von teurer Gnade abhängig ist und dass eine platte Entschuldigung auch vom besten Menschen vor Gott einfach nie reicht, um die Sünde zu sühnen: Es brauchte das Kreuz, um das Unentschuldbare zu vergeben.
Verletzte Personen werden hier ermutigt, die eigenen Verfehlungen, aber auch die der Menschen um sie herum begründet anzugehen und dann die Schönheit der konkreten Vergebung zu erleben, die vom Kreuz her möglich ist.
Kann es sein, dass zwischen Menschen reservierte Beziehungen bestehen, weil echtes Vergeben und Versöhnen nicht umgesetzt wird? Daher ist dieses Buch mit den anschaulichen, sehr greifbaren Gedankengängen und mit den vielen praktischen Anregungen (auch in den vier Anhängen) gewinnbringend für Theologen, engagierte Gemeindemitarbeiter und vor allem für Personen, die Menschen seelsorgerlich begleiten, um die inneren Auseinandersetzungen rund um Vergeben und Versöhnen zu durchschauen und beantworten zu können.
Man sollte sich allerdings Zeit zum reflektierenden Lesen gönnen, weil es Keller nicht um schnelle Antworten geht, sondern darum, die eigene Not und das Ausmaß von Vergeben im Gesamtkontext zu verstehen. Immer wieder kreist er um die Kernaussagen, daher wirkt die Struktur anfangs etwas verwirrend. Es wird ein ehrliches Mitdenken abverlangt, denn Keller ist sehr konkret und aufrüttelnd, indem er das, was der Mensch innerlich diskutiert, ungeschminkt formuliert. Menschen müssen irgendwie mit dem Zerstörten im Leben umgehen, daher ist Vergeben das zentrale Dauerthema, um das Evangelium im Alltag wirksam zu erleben und auszudrücken.
Buch
Timothy Keller, Vergeben – Warum eigentlich? Und wenn ja – wie?, Gießen: Brunnen, 2024, 272 Seiten, 22 EUR.