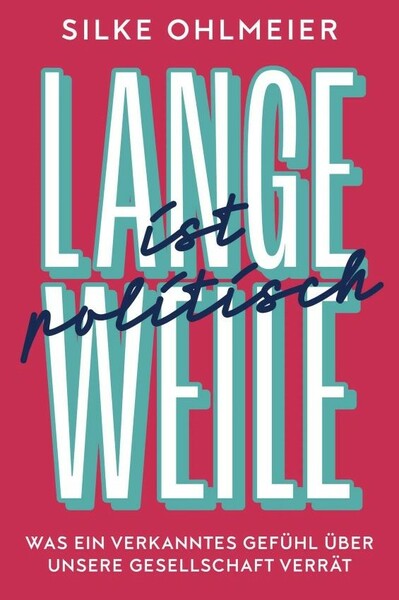
Langeweile ist politisch
Es gibt Dinge, die alle Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Welt kennen: Hunger, Durst und Müdigkeit. Freude, Trauer und Angst … und Langeweile! Silke Ohlmeier ist Soziologin und erzählt in ihrem Buch ihre ganz eigene Geschichte, die sie zudem mit jahrelanger Forschung verbindet.
Sie beginnt darin im ersten Kapitel, indem sie schildert, wie mühsam ihre Ausbildung zur Industriekauffrau war. Der Grund hierfür war allerdings nicht Überforderung, sondern zu wenig sinnvolle Arbeit bei gleichzeitigem Leistungsdruck. Beruflich ist sie später andere Wege gegangen, doch die Frage, wieso Langeweile derart belastend sein kann, ließ sie nicht los.
Der Blick über den Alltag hinaus
Was macht Langeweile aus? Darum geht es in den Kapiteln 2 und 3. Langeweile scheint universal zu sein, denn wir sehen generell: „Der Wunsch nach einer befriedigenden Tätigkeit und das Streben nach der Entfaltung unserer Interessen ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis“ (S. 20).
Für Ohlmeier sind Menschen, die in der Langeweile feststecken, wie Pflanzen ohne Licht. Das ist ein passendes Bild. Schließlich begünstigt Langeweile laut Studienlage körperliche und seelische Krankheiten – nicht nur, weil Menschen auf ungesunde Weise mit ihrer Unzufriedenheit umgehen.
Da Menschen Langeweile nicht einheitlich erleben, arbeitet die Autorin mit einem weit gefassten Begriff. Mit Verweis auf den Psychologen John Eastwood definiert sie Langeweile als die unangenehme Erfahrung, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können.
Ohlmeier skizziert nachvollziehbar, inwiefern Langeweile uns Menschen ganzheitlich in Beschlag nimmt und welche weiteren Gefühle da oftmals noch hinzukommen. Hilfreich ist vor allem ihre Dreiteilung: Es gibt erstens die situative Langeweile, die einfach zum Alltag dazugehört. Wenn Menschen jedoch über längere Zeit zu viel Langeweile erleben, kann man zweitens von einer chronischen Langeweile sprechen. Die extremste Form ist drittens die existenzielle Langeweile.
Wie lässt sich dieses unangenehme Gefühl noch konkreter verstehen? Dazu wirft Ohlmeier einen Blick in die Geschichte und geht auf viele unterschiedliche Erklärungsmodelle ein. Schließlich entscheidet sie sich aber für eine kritische Sicht auf die Gesellschaft.
Privat = politisch?
In Kapitel 4 erläutert Ohlmeier ihre Ansicht, dass unser persönliches Leben hochgradig politisch ist. Jeder Mensch wird von der Gesellschaft nachhaltig geprägt; zugleich lebt und drückt er seine Überzeugungen im Alltag aus. Somit gibt es für die Soziologin eigentlich keine Neutralität mehr, auch weil Frust durch Langeweile die Menschen oft dazu antreibt, sich unsolidarisch zu verhalten. Dieser Denkansatz erlaubt ihr rückwirkend die kritische Frage: Welche sozialen Zwänge verursachen bei welchen Menschen chronische Langeweile?
Hier erklärt sich das tiefere moralische Anliegen der Autorin: Sie möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, „dass Langeweile ein Ausdruck gesellschaftlicher Ungerechtigkeit ist und wir ihre antreibende Kraft dafür nutzen können, die Welt zu einem gerechteren Ort zu machen“ (S. 50). Kritische Leser werden sich fragen, was Ohlmeier konkret mit „politisch“ meint und an welchen Stellen es einfach nur „moralisch“ oder „ethisch“ bedeuten soll. Auch werden nicht alle bei der Gleichsetzung der verschiedenen Sphären mitgehen wollen. Ja, die private und die politische Sphäre sind untrennbar miteinander verflochten. Zugleich aber lassen sie sich notwendigerweise unterscheiden. Der Bereich der Zivilgesellschaft (eine wichtige Brücke zwischen dem Privaten und dem Öffentlich-Politischen) bleibt hier leider komplett ungenannt oder scheint nur verschwommen durch einzelne Argumente hindurch. So oder so scheint es problematisch, das Private als komplett politisch zu definieren – sei es rein von seiner Funktion her oder als Vorbedingung für eine herrschaftskritische Analyse, die ja auch nicht neutral ist.
Über Missverständnisse, Ausgrenzungen und Privilegien
Mancher Leser wird sich in Kapitel 5, in dem die Autorin auf einige Mythen zur Langeweile eingeht, wiederentdecken. Ein Großteil der Menschen fühlt sich heute zu ständiger Aktivität gedrängt – sei es, um einer inneren Leere zu entgehen oder dem Anschein von Faulheit vorzubeugen. Wer so lebt, wird Negatives im eigenen Leben selten hinterfragen, geschweige denn aus der Langeweile heraus den Antrieb finden, Dinge positiv zu verändern.
Einzelne Bemerkungen aus dem Buch klingen besonders nach. Dazu gehört die Einsicht, dass sich die Langeweile „erst in der Moderne zu einem nennenswerten Phänomen entwickelt hat. Es klingt … paradox, dass ausgerechnet die (Post-)Moderne mit all ihren Selbstverwirklichungs- und Unterhaltungsangeboten besonders viel Langeweile hervorgebracht haben soll“ (S. 86).
Im Supermarkt an der Kasse stehen, auf dem Heimweg von der Arbeit im Stau festhängen, mit den Kindern zum x-ten Mal dasselbe Spiel spielen – die situative Langeweile ist ein Alltagsphänomen und betrifft ausnahmslos alle. Doch darüber hinaus lautet ihre These: Gruppen, die in der Öffentlichkeit wenig Beachtung finden, erleben besonders stark chronische Langeweile. Im weiteren Verlauf von Kapitel 6 erläutert sie dann, inwiefern Menschen aufgrund ihrer sozialen Klasse, Gender, Race und Disability im konkreten Alltag belastende Langeweile und soziale Ungerechtigkeit erleiden.
Eine wichtige Ergänzung bietet das Kapitel 7. Ohlmeier sagt gerade nicht, „dass sämtliche Menschen, die in irgendeiner Form von Marginalisierung betroffen sind, ständig gelangweilt wären oder privilegierte Menschen niemals“ (S. 133), denn: Viele Menschen in schwierigen Lebenslagen gehen beeindruckend damit um. Auch können Menschen in höheren Schichten, die Wohlstand und Ansehen genießen, unter belastender Unzufriedenheit leiden. Einige Beobachtungen klingen dabei etwas widersprüchlich, doch Ohlmeier möchte hier vielmehr eine menschenschädliche, kapitalistische Logik aufdecken. Trotz manch interessanter Anfragen und teils sinnvoller Kritik stellt sich spätestens hier die Frage: Welche Lösungsansätze hat sie zu bieten?
Auf dem Weg zu einem sinnvollen und erfüllenden Leben
Mit Verweis auf den bekannten Soziologen Hartmut Rosa und seine Resonanztheorie warnt Ohlmeier vor einer „stummen Weltbeziehung“. Ihre Überzeugung lautet: Konsum und pausenlose Aktivität schaffen keine Zufriedenheit. Noch mehr Dinge in dieser Welt zu besitzen und über sie Kontrolle auszuüben, kann nicht die Lösung als Individuen oder als Gesellschaft sein.
Umgekehrt spricht sich die Autorin dafür aus, Langeweile wieder neu zu spüren und zu akzeptieren, quasi als Zwischenstation „auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben“ (S. 153), mit neuen Prioritäten und einer gesünderen Lebensgeschwindigkeit. Anstatt eine toxische Positivität zu bedienen oder in Kategorien von produktiv und untätig zu denken, strebt Ohlmeier mit Erich Fromm somit etwas Größeres an: „Eine lebendige Beziehung zu dem, was ich tue oder was mich umgibt. Eine Art Dialog zwischen mir und den anderen Menschen, Dingen oder Tätigkeiten“ (S. 156).
Anders denken, anders reden, anders leben?
Was folgt daraus? Die Autorin plädiert in Kapitel 9 dafür, Langeweile neu zu denken und anders darüber zu reden. Anstatt Personen oder Dinge als langweilig abzuwerten, sollte man das subjektive Erleben stärker betonen. Das verhindere nicht nur negative Machtgefälle zwischen Menschen, sondern helfe auch dabei, die eigene Prägung zu hinterfragen und handlungsfähiger zu werden.
Kapitel 10 dient als Abschluss von Ohlmeiers Kritik der Langeweile. Diese sei oft kein „selbstverschuldetes Gefühl, sondern die Folge von Normen, Zwängen und Machtverhältnissen. Manchmal auch hervorgerufen durch ein falsches Verständnis davon, was Langeweile ist“ (S. 163).
Folglich sollte es nicht mehr das Privileg von einigen wenigen sein, ihre eigenen Interessen auszuleben. Dabei erinnert sie als Soziologin an die Wechselbeziehung von Einzelperson und Gesellschaft, was bedeutet: Veränderungen beginnen immer auch auf der persönlichen Ebene. Somit ermutigt Ohlmeier ihre Leser dazu, chronische Langeweile zu hinterfragen, sie nach Möglichkeit zu überwinden und dort politisch aktiv zu werden, wo Langeweile eine Folge ungerechter Strukturen sei.
Im Rückblick scheint es, als würde die Autorin immer wieder stark mit einem populären Verständnis von „Macht“ arbeiten. Kritisch könnte man fragen: Inwiefern ist Macht nicht auch eine kreative Kraft und essentiell für eine Gesellschaft, ihre Milieus und Mitglieder? Inwiefern führt Macht eben nicht pauschal zu „Unterdrückung“, worauf ja sogar säkulare Denker wie Michel Foucault hingewiesen haben? Kritische Leser werden außerdem wissen wollen, mit welchem höheren Maßstab man negative Prägungen erkennen und ungerechte Strukturen bewerten solle, oder ob dies alles am Ende vom persönlichen Gusto abhängt. Auch das Konzept einer „lebendigen Weltbeziehung“ klingt hier zunächst spannend, hilft aber nur sehr begrenzt weiter.
Lesenswert mit Beigeschmack
Wer hat sich nicht schon einmal im Griff der Langeweile wiedergefunden? Silke Ohlmeier behandelt in ihrem Sachbuch ein Thema, mit dem quasi alle etwas anfangen können. Ihr soziologischer Ansatz wirkt anfangs etwas ungewöhnlich, ist aber nach ein paar Seiten interessant zu lesen. Einerseits geht die Autorin kohärent vor, wertet relevante Studien aus und benennt Forschungslücken. Andererseits schreibt sie griffig und sympathisch, mit allerlei Beispielen aus dem Alltag. Mehrmals dachte ich während der Lektüre: Großartig, genau so schreibt man gute Sachbücher!
Ein gewisser Beigeschmack stellte sich bei mir ab Kapitel 6 ein. Dass Langeweile ein Symptom von sozialer Ungerechtigkeit sein kann, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Dazu erklärt die Autorin transparent und mit Bedacht, was der intersektionale Ansatz meint und inwiefern einzelne Personengruppen am Beispiel der Langeweile ein Stück weit soziale Ausgrenzung erfahren können. Gleichzeitig ist die Autorin bemüht, nicht nur strikt und stur innerhalb der Kategorien von Klasse, Gender, Race und Disability zu denken (die Kategorie Alter kommt nur indirekt mit Blick auf Kinder vor).
Ohlmeier schreibt abwägend, geht auf Gegenbeispiele ein und versucht, diese in ihre Thesen zu integrieren. Doch ab einem bestimmten Punkt schreibt die Soziologin derart differenziert (völlig zu Recht), dass der intersektionale Ansatz mit seinem methodischen und weltanschaulichen Ballast nicht mehr allzu hilfreich wirkt. Hier bietet der christliche Glaube meiner Ansicht nach zwingend bessere Ressourcen und Denkkategorien. Von einer christlichen Weltsicht und Sozialethik her gibt es mit Gottes Offenbarung und Gesetz ja einen universalen, aber fraglos guten und lebensfördernden Maßstab. Der wiederum steht jenseits aller menschlichen Kultur und bietet (direkt oder abgeleitet) korrigierende Perspektiven und praktische Hilfen für unsere persönlichen und gesellschaftlichen Nöte.
Schwierig wird es zusätzlich, wenn Personen nach ihren individuellen Eigenschaften, sozialen Zugehörigkeiten und Erfahrungen kategorisiert werden, um sie dann aufgrund ihres potentiellen Opferseins gegeneinander aufzuwiegen. Das ist paradox, denn hier führt die Identitätspolitik in ihrem Streben nach Individualität und Gerechtigkeit eigentlich nur zu weiteren Machtkämpfen und illiberalen Tendenzen. Man könnte auch sagen: Mit der intersektionalen Perspektive fördert man langfristig eher Neid und Misstrauen in einer Gesellschaft, während Dinge wie Empathie, Großzügigkeit und Selbstlosigkeit zwangsläufig in den Hintergrund müssen. Wir sehen schon, wie grundsätzlich und zugleich lebenspraktisch das Thema der Langeweile in Wirklichkeit ist, einfach weil es so existentiell unser Menschsein betrifft.
Am stärksten schien mir das Buch in solchen Momenten, in denen sich die Autorin an die existenzielle Langeweile heranwagt. Wieso empfinden wir so? Was ist schiefgelaufen, dass das Leben nicht so ist, wie es sein sollte? Und wie können wir sinnvoll leben, obwohl unser Leben nur ein Hauch ist?
Zynische Skeptiker werden solche Fragen beiseiteschieben oder den Philosophen überlassen wollen. Doch indem Ohlmeier einflussreiche Denker wie Fromm und Rosa zu Wort kommen lässt, erinnert sie daran: Wir sollten unser Unbehagen an der Moderne ernst nehmen und noch tiefere Fragen stellen.
Religion hat für die Autorin als Sinnquelle ausgedient. Das kann man zwar mit guten Gründen anders sehen, doch es erklärt, warum sie sich bis auf wenige Ausnahmen in einem rein innerweltlichen Denkrahmen bewegt. Auch wenn viele ihrer Impulse über sich selbst hinausweisen, spricht sie vor allem Punkte an, die nur die vorletzten Fragen berühren. Aus soziologischer Sicht mag Langeweile ein unterschätztes Symptom und die ungerechte Gesellschaft ihre Ursache sein. Aus theologischer Sicht jedoch sind beide ernstzunehmende Anzeichen eines noch viel tieferen und schwerwiegenderen Problems.
Unsere Langeweile auszuhalten, um uns dann von ihr zu Besserem antreiben zu lassen – das ist eine gute Sache, solange wir hierbei die richtige Richtung einschlagen. Verantwortlich zu leben und zu einer gerechteren Gesellschaft beizutragen – das ist zweifellos wichtig und richtig. Doch den „Weg zum Leben“, „Freude in Fülle“ und „ungetrübtes Glück“ (Ps 16,11) können wir am Ende niemals selbst oder gar aus uns heraus produzieren. Selbst die existenzielle Langeweile ist im Licht der Bibel nur ein Symptom. Sie ist eine dringende Erinnerung daran, dass jemand von außen mit Güte und Macht kommen, uns befreien und verändern muss. Gerade das darf die christliche Gemeinde heute umso beherzter bezeugen. Gerade hier darf sie heute umso radikaler einen Unterschied mit ihrer Jesus-Nachfolge machen.
Buch
Silke Ohlmeier, Langeweile ist politisch: Was ein verkanntes Gefühl über unsere Gesellschaft verrät, Graz: Leykam, 2023, 192 Seiten, 23 EUR.