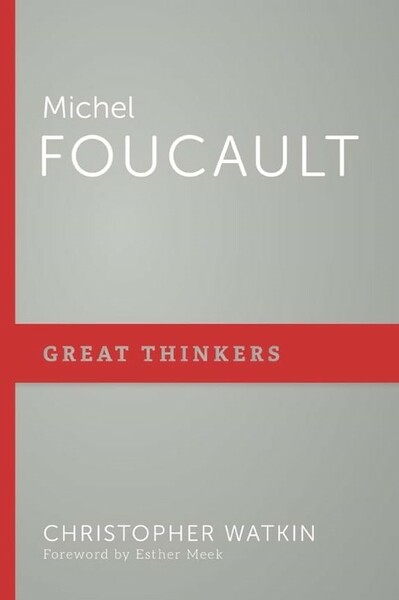
Michel Foucault
Schaut man auf das 20. Jahrhundert zurück, so stechen einige Persönlichkeiten heraus. Da sind z.B. Politiker und Machthaber, die gewichtige Entscheidungen getroffen haben. Stellenweise haben Sportler die Menschen mit ihren Höchstleistungen begeistert und inspiriert. Auch manche Musiker, Schauspieler und andere Künstler bleiben uns im Gedächtnis.
Nicht ganz so auffällig, aber dennoch einflussreich, sind die Intellektuellen. Mit ihren Theorien, Analysen und Gedanken haben sie nicht nur kurzlebige Trends angestoßen, sondern ganze Gesellschaften nachhaltig geprägt.
Ideen haben Folgen
Ideen können unser Leben massiv und tiefgreifend verändern. Nur, in welche Richtung? Ein überaus einflussreicher Denker des letzten Jahrhunderts war der französische Philosoph Michel Foucault (1926–1984). Wer sich z.B. ernsthaft mit dem Phänomen der Postmoderne auseinandersetzen möchte, wird um diesen intelligenten atheistischen Denker nicht herumkommen.
Auch wenn Foucault sich selbst nicht als postmodernen Denker sah und nicht die einzige Schlüsselperson für diese Epoche ist; auch wenn der Höhepunkt der Foucault-Renaissance längst überschritten ist – seine Thesen und Anfragen waren rückblickend ein Katalysator für den westlichen Kulturkreis. Sie lassen sich noch heute im Bereich der Philosophie, Soziologie, Pädagogik, Kunst, sowie in den Politik-, Geschichts-, Kultur-, Medien- und Sprachwissenschaften, und nicht zuletzt in den unterschiedlichsten Ansätzen der Gender Studies ablesen. Doch wofür stand der französische Philosoph und wie können sich Christen zu ihm positionieren?
Um Foucaults Werk und Person zu verstehen, bietet Christopher Watkin eine kompakte, gut lesbare und zugleich tiefgehende Einführung. Der britische Autor arbeitet als Professor für französische Literatur und Philosophie an der australischen Monash University (Melbourne). Er zeigt, wie man sich Foucault neugierig und kritisch nähern kann, entwickelt dabei aber einen ganz eigenen Ansatz, der den Lesern kernige Alternativen zu Foucault bietet.
Für wen ist dieses Buch interessant? Christen, die philosophisch, theologisch oder apologetisch interessiert sind, werden hier eine gelungene Analyse finden; ebenso Gläubige, die im Bereich der Sozial- und Verhaltenswissenschaften unterwegs sind. Auch Leser mit ganz anderen Überzeugungen und einer atheistischen Weltanschauung können viel von Watkins Studie lernen und ihn als angenehmen, fairen und herausfordernden Gesprächspartner wahrnehmen.
Ein komplexes Werk auf wenigen Seiten?
Auf dem Markt gibt es eine ganze Reihe an Einführungen zu Michel Foucault. Sein Werk ist komplex und als Denker passt er nicht so recht in eine einzige Schublade. So wählen unterschiedliche Autoren für ihre Einführungen mal einen biographischen, mal einen chronologischen, oder auch einen thematischen Ansatz. Einige konzentrieren sich besonders auf Foucaults Hauptwerke, während andere ihn eher von seinen Vorlesungen und Interviews her zu verstehen versuchen – mal analysierend und neutral beschreibend, mal kritisch-kreativ oder sogar aktiv werbend. Watkin hingegen nimmt seine Leser mit auf einen Weg, der einige dieser Ansätze kombiniert.
Das Buch beginnt zunächst mit einem anregenden Vorwort der Philosophieprofessorin Esther Meek. Danach erklärt Watkin die Relevanz und den Einfluss von Foucault, ebenso die methodisch begrenzte Auseinandersetzung mit dem französischen Philosophen aus theologischer Sicht. Interessant ist in seinen Augen, dass Foucault ein fundamental anderes Weltbild als das der Bibel propagiert, zugleich aber intensiv und kritisch die Denkvoraussetzungen der Moderne hinterfragt. Auch präsentiert Foucault bewusst gegenläufige Perspektiven und Geschichten, um die Menschen in der problematischen Gegenwart wachzurütteln und ihnen alternative Lebensentwürfe vor Augen zu malen. Dieses Anliegen können viele Christen sicherlich nachvollziehen, auch wenn sie es inhaltlich anders füllen würden.
Was ist wahr, bleibend und bindend?
Im ersten Teil seines Buches fasst Watkin Foucaults Denkweg zusammen, indem er es in drei Phasen einteilt, auf die jeweiligen Hauptwerke eingeht und in den einzelnen Kapiteln, je nach Thema, ergänzende Erklärungen bietet. In einer ersten Wirkungsphase (Kapitel 1) setzte er sich besonders mit Fragen von „Wahrheit“ und „Geschichte“ auseinander. Watkin erläutert hierbei den Einfluss von Hegel, Marx und Nietzsche auf Foucaults Denken und wie er deren Anliegen weiterführte bzw. sich von ihnen abgrenzte.
Insbesondere in seinem Werk Wahnsinn und Gesellschaft (1961, dt. 1969) fragte der französische Denker danach, was zu bestimmten Zeiten kulturell möglich, denkbar und sagbar war. Mit einem Gang durch die Epochen der Renaissance, Klassik und Moderne zeichnet Foucault die damals geltenden Denkregeln und Denkvoraussetzungen nach. Dabei hinterfragt er ein allgemeines Weltbewusstsein, Fortschritt und Universalität (vgl. Hegel, Marx, Nietzsche). Foucault unterstreicht hauptsächlich das Zeitgebundene, das Relative des Lebens. Am Ende des Kapitels wertet Watkin unterschiedliche Kritikpunkte an Foucaults Methoden und Geschichtsverständnis aus, die andere Akademiker im Laufe der Zeit geäußert haben.
Wer entscheidet über mein Leben?
In Kapitel 2 stehen die Schlüsselbegriffe „Macht“ und „Wissen“ im Zentrum, um Foucaults genealogische Phase der 1970er-Jahre näher zu beschreiben. Hier verschob sich sein Interesse weg von sprachlichen Untersuchungen und hin zu Fragen von Verhaltensweisen und politischen Perspektiven. Mit diesem besonderen Fokus versuchte er, die Menschen im Heute besser zu verstehen. Mit Blick auf Macht (mittlerweile ein kontroverser Begriff im globalen Westen) listet Watkin neun Thesen auf, die Foucaults Ansatz verständlicher machen und außerdem manch populäres Missverständnis korrigieren:
- Macht ist kein abstraktes, unabhängiges Konzept, sondern kennzeichnet Beziehungen.
- Macht ist nicht nur ein Verhältnis zwischen Unterdrücker und Unterdrückten.
- Macht kann man nicht besitzen, man ist vielmehr in sie eingebunden.
- Macht ist überall, aber sie ist nicht alles.
- Machtverhältnisse sind nicht offensichtlich.
- Macht ist kreativ, nicht pauschal unterdrückend.
- Das menschliche, aktive Subjekt steht in einem andauerndem Wechselspiel von Macht und Widerstand.
- Macht verdreht nicht Wissen, es ist stets ein schöpferischer, innerer Teil von Wissen.
- Macht ist nicht das Gleiche wie Gewalt, Herrschaft oder Willenskraft.
Ausgehend vom Werk Überwachen und Strafen (1975, dt. 1976) vertieft Watkin schließlich Foucaults Kategorien von adelig-souveräner Macht, kirchlich-pastoraler Macht, Disziplinarmacht und Bio-Macht (Regulierung des Körpers und der Gesellschaft). Auch geht er auf die Illustration des Panoptikums als das „ideale“ Gefängnis mit einer gegenseitigen Überwachung ein. Mögliche Kritikpunkte dieser Phase sieht Watkin u.a. in der Frage, wie zulässig oder (in)konsequent Foucault von seinen Grundüberzeugungen und Geschichten auf das gelebte Leben in der Gesellschaft schließen konnte.
Wer will ich sein und wie will ich leben?
In den 1980er-Jahren verschob sich Foucaults Fokus erneut, dieses Mal hin zu ethischen Fragen. Allerdings verstand der Philosoph die Ethik primär im Verhältnis des Einzelnen zu sich selbst. Moral war für ihn maßgeblicher Teil eines Selbstbildungsprozesses, bei dem man z.B. den eigenen Körper unterschiedlichen Disziplinen oder Regeln unterwirft. So werden Sexualität und Identität zu besonderen kulturellen Schlüsselthemen, die Foucault (überraschenderweise) stark vom Christentum her beeinflusst sah. Letztlich hätten die christlichen Konzepte von Selbstreflexion und Wahrheit zusammen mit den Praktiken von Beichte und Bekenntnis die Gesellschaft durchzogen und die moderne Seele mitgeprägt, so Foucault, bis in die intimsten Bereiche des Lebens und des menschlichen Seins.
Zentral an diesem Punkt ist das Buch Der Wille zum Wissen: Sexualität und Wahrheit 1 (1976, dt. 1977), in dem Foucault auf missverständliche Vorstellungen von sexueller Unterdrückung und Befreiung in der Geschichte eingeht. Die 1960er-Jahre hätten nicht eine neue sexuelle Revolution losgetreten, sondern vielmehr längst bestehende Entwicklungen beschleunigt. Ein Kerngedanke lautet: Weil Sexualität durch gesellschaftliche Debatten geregelt würde und aufs Engste mit der eigenen Identität verbunden sei, drängt Foucault auf eine Transformation des Selbst, auf prägende „Grenzerfahrungen“ im Hinblick auf Identität und Sexualität, und schließlich auf eine aktive Veränderung des gesellschaftlichen Dialogs.
Wozu das alles? Um Menschen aus ihrem normalen, eingrenzenden Leben zu befreien und mehr zu sich selbst kommen zu lassen. Am Ende von Kapitel 3 steht wieder eine kurze Auswertung: Watkin betont, dass Foucault keine pauschale, einseitige Geschichte der Emanzipation und Befreiung im Sinn hatte. Machtverhältnisse ließen sich in Foucaults Denken zwar niemals auflösen, doch zumindest sollte das Individuum maximal autonom sein, sich selbst verwirklichen können und frei von disziplinierenden Einflussnehmern und Beherrschern außerhalb von sich selbst sein, wie z.B. Staat, Kirche, Gesellschaft und Konzerne.
In Kapitel 4 fasst Watkin einige Kernanliegen aus dem ersten Teil noch einmal zusammen und erklärt, wie ausgewählte Autoren aus theologischer Sicht auf Foucault reagiert, ihn kritisiert oder weitergedacht haben.
Eine bessere Geschichte und Lebensweise
Im zweiten Teil seiner Einführung wechselt Watkin von der analytischen Beschreibung hin zu einem biblisch-konstruktiven Gegenentwurf. Er möchte Foucault nicht nur fair verstehen und ihn anderen erklären, sondern ihn ernst nehmen und konstruktiv hinterfragen, d.h. seine Ausführungen weiterdenken, noch tiefgreifendere Fragen stellen und bessere Antworten finden. Dazu geht Watkin von der Bibel her und christuszentriert auf die verschiedenen Kernthemen und Schlüsselbegriffe ein, die Foucaults Denken, Gesellschaftskritik und Menschenbild angetrieben haben.
„Das Evangelium prägt und verändert die Geschichte und fördert ‚einen Lebensrhythmus, eine Ethik und eine Sichtweise auf die Welt und das Leben in ihr‘, die eine schöne, gute und wahrhaftige Alternative zu Foucaults kritischem Weltbild und den daraus folgenden Lebensentwürfen darstellt.“
Im Bild gesprochen: Der christliche Professor fungiert ab hier nicht mehr nur als Dolmetscher, sondern auch als ein Gesprächspartner auf Augenhöhe, damit Foucaults Positionen nicht als Monolog unhinterfragt für sich dastehen. Gleichzeitig aber möchte er seinen Lesern als eine Art Sprachlehrer dienen, damit sie sprachfähig werden und reflektiert mit Foucaults eigenen Begriffen und Gedanken weiterarbeiten.
Hierzu geht Watkin zunächst auf mögliche Grenzen und Kritikpunkte an seiner Methode ein und präsentiert dann seinen Ansatz der „kreuzförmigen, großen Umkehrung“. Die kommt bereits an vielen kleinen Stellen in der Bibel vor und findet ihren Höhepunkt am Kreuz. Watkin meint hierbei jene „Dynamik, mit der Gott die Erwartungen der Welt in Bezug auf Weisheit und Macht unterwandert, um die Schwachen, Törichten und Machtlosen zu erwählen und so seine Absichten zu realisieren“ (S. 79). Die Realität und Wahrheit des stellvertretenden Sühneopfers Jesu und seiner wirklichen, wahrhaftigen Auferstehung von den Toten hat nach Watkins Überzeugung überwältigende Folgen. Das Evangelium prägt und verändert die Geschichte und fördert auf persönlicher Ebene „einen Lebensrhythmus, eine Ethik und eine Sichtweise auf die Welt und das Leben in ihr“ (S. 81), die eine schöne, gute und wahrhaftige Alternative zu Foucaults kritischem Weltbild und den daraus folgenden Lebensentwürfen darstellt.
Dazu legt Watkin in Kapitel 5 den Bibelabschnitt Philipper 2,5–11 aus und wendet ihn zunächst auf Foucaults Geschichtsverständnis an. Im Kreuz zeigt sich eine viel tiefere Gegensätzlichkeit der menschlichen Existenz, als Foucault es in seinen Analysen aufdecken konnte. Zugleich unterwandert das Kreuz die menschliche Gier nach Herrschaft und den weltlich verstandenen, gleichförmigen Aufstieg zu Macht und Ehre. Gott der Sohn ist freilich und notwendigerweise von außen in diese Welt hineingekommen. Er hat sich klein und zerbrechlich gemacht. Diese Realität und Wahrheit macht es möglich, dass wir uns nicht mehr naiv mit den Gegebenheiten des Lebens abfinden. Auch erklärt Watkin, wie das Evangelium Foucaults Kritik an Hegels Geschichtsphilosophie noch weiter verschärft, und wie das Kreuz nicht bloß Brüche in der Zeit aufdeckt, sondern einen Bruch der Zeit selbst darstellt.
Dass Christus für Sünder ans Kreuz ging, ist kein Paradebeispiel für eine menschenverachtende, ungesunde Selbstleugnung in der Lesart Foucaults. Vielmehr offenbart sich im Kreuz eine aktive, heilige, sich selbst schenkende Liebe. Diese ermöglicht sowohl eine versöhnte Beziehung zu Gott als auch einen befreiten Gehorsam – gerade, weil Schöpfer und Geschöpf sich nicht einfach auf Augenhöhe begegnen. Foucaults Kritik an (französisch-katholischer) Religion und ihrer negativen Prägekraft in Form von Heuchelei und falscher Selbstverleugnung sollte laut Watkin eine ernstzunehmende Warnung vor einer unbiblischen Gesetzlichkeit und vor blindem Glauben sein. Diese Kritik sollten sich auch bibeltreue Christen gefallen lassen. Dennoch ignoriert Foucault die Realität des befreiten, neuen Lebens der Menschen, die wirklich mit Christus vereint sind.
Das Kreuz und eine andere Art Macht
In Kapitel 6 geht es dann darum, wie das Kreuz unser Verständnis von Macht umkehrt und zugleich Foucaults Philosophie unterwandert. Ausgangspunkt ist hier 1. Korinther 1,18–31, wobei Watkin diese Verse schrittweise auslegt und auf die Ausführungen aus dem ersten Teil des Buches anwendet. Gottes Macht und Weisheit unterwandern das menschliche Streben nach Einfluss durch Macht und Weisheit, um es dann neu zu füllen. Während Wahrheit in ihren Ansprüchen für Foucault kritisch zu sehen und stets begrenzt war (was eine positive Norm, die Orientierung und Gerechtigkeit bieten und für alle Menschen gelten könnte, unmöglich macht), präsentiert sich das Evangelium als die eine, universale Wahrheit.
„Hier zeigt sich wahre, gute und reale Macht: Christus gab sein Leben im freiwilligen Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber, um seine Feinde vor Gottes Zorn und seinem gerechten Gericht zu retten.“
Weil das Evangelium als wahre Wahrheit überörtlich und überzeitlich ist, gilt der Anspruch und Zuspruch des Evangeliums diskriminierungsfrei für alle Menschen. Das Evangelium hängt nicht von Menschen ab, auch wenn es sich unterschiedlich in der menschlichen Geschichte auswirkt. Hier zeigt sich wahre, gute und reale Macht: Christus gab sein Leben im freiwilligen Gehorsam seinem himmlischen Vater gegenüber, um seine Feinde vor Gottes Zorn und seinem gerechten Gericht zu retten. Wenn man darüber nachdenkt, macht das letztlich jeden Versuch zunichte, dass Menschen z.B. sich selbst erhöhen, eine andere soziale Gruppe benachteiligen oder die eigene Agenda als absolut setzen könnten.
Anstatt Machtmissbrauch oder krankhafte Selbstverleugnung zu propagieren, lautet die christliche Botschaft: In Christus ist wirklich ein neues Leben möglich, das positiv über alle Befürchtungen und Hoffnungen des Menschen hinausgeht – bei dem weder Gott noch andere Menschen manipuliert werden könnten, und bei dem Christus uns die unmögliche Last der Selbsttransformation abnimmt. Er befreit uns aus unserer Rebellion gegen äußerliche, missbräuchliche Mächte. Bei ihm finden wir Ruhe und eine Neuordnung unserer Beziehungen, aber nicht nur das – und dies leitet zum letzten Thema über.
Das Kreuz und die Frage nach unserer Identität
In Kapitel 7 geht es schließlich ausführlich um die Frage nach dem Ich. Foucault richtete sich in seinen Werken gegen eine verschlossene Identität, die von der Normalität kontrolliert wird. Intensiv warb er dafür, dass Menschen sich hin zu einer tiefgehenden Veränderung des Selbst öffnen, z.B. durch Grenzerlebnisse und Tabubrüche (daher auch Foucaults Forschungsinteresse an dem kulturellen Umgang mit psychischen Krankheiten, Kriminalität und abweichenden Sexualpraktiken).
Nach Watkins Einschätzung jedoch präsentiert der französische Philosoph eine recht begrenzte Sicht von Identität und Veränderung. Diese führt er vor allem auf ein erkenntnistheoretisches Problem zurück. Dem wiederum stellt Watkin eine biblische Alternative aus 1. Korinther 1 und Galater 2,20 entgegen, mit einer alternativen Sicht von existenzieller Offenheit und Verschlossenheit, von Autonomie und Fremdbestimmtheit. Watkins Analysen, Argumente und Impulse aus diesem wichtigen Kapitel sind beachtenswert, grundlegend und erbaulich zugleich.
Abschließend blickt Watkin in Kapitel 8 noch einmal auf seine Einführung zu Foucault zurück. Dabei benennt er methodische und inhaltliche Grenzen seiner Arbeit sowie offen gebliebene Fragen. Zugleich lädt er seine Leser ein, seine Impulse weiterzudenken und sie zu hinterfragen, sowohl aus Foucaultschem Blickwinkel als aus christlicher Perspektive.
Im Anhang des Buches findet sich noch ein kommentierter Überblick zu Michel Foucaults Hauptwerken und zu seinen Schaffensphasen. In einem sehr hilfreichen Glossar erklärt Watkin außerdem ausgewählte Schlüsselbegriffe, Namen und Methoden. Das Quellenverzeichnis ist zum Teil ebenfalls kommentiert und listet sowohl die relevante Primärliteratur von Foucault als auch weiterführende Sekundärliteratur über den französischen Philosophen auf. Ein Bibelstellenverzeichnis und ein Schlagwortregister runden diesen bemerkenswerten Band schließlich ab.
Mehr als nur Erklären und Hinterfragen
Was macht dieses Buch so nützlich? Christopher Watkins Einführung zu Michel Foucault ist sinnvoll aufgebaut. Einerseits konzentriert er sich auf die großen Linien und Schlüsselthemen in Foucaults Werk, andererseits ergänzt er seine Ausführungen mit biographischen Details oder mit Zitaten aus weniger bekannten Werken. Neben einigen Hinweisen auf Foucaults Wirkungsgeschichte verweist der christliche Professor auch auf intellektuelle Abgrenzungen und gedankliche Querverbindungen – nicht nur zu Hegel, Marx und Nietzsche, sondern auch zu weniger bekannten Denkern aus dem Foucaultschen Universum.
Der Schreibstil und die Sprache sind, wie typisch für Watkin, außerordentlich leserfreundlich. Nützliche Grafiken illustrieren an wichtigen Stellen jene Konzepte, Begriffe und Muster, die Foucaults Thesen zugrunde liegen oder auf die es Watkin in seinen eigenen Argumenten ankommt. Beim Lesen wird deutlich: Der Autor kennt nicht nur sein Fachgebiet, er kann es auch anderen vermitteln. Anstatt „nur“ zu erklären und Foucaults Positionen zu hinterfragen, bemüht sich Watkin um eine Haltung kritischer Sympathie. Er möchte den französischen Denker wirklich verstehen, positive Anknüpfungspunkte finden und dann genau mit diesen weiterarbeiten, ohne sich jedoch Foucault anzubiedern oder seine Denkvoraussetzungen zu übernehmen. Dabei arbeitet er intensiv mit der Bibel und lässt auch relevante Stimmen aus der Kirchengeschichte zu Wort kommen. Das alles macht Watkins Analysen im ersten Teil des Buches so treffend und seinen dreiteiligen Gegenentwurf im zweiten Teil so effektiv. Von dieser Vorgehensweise lässt sich viel lernen.
Nimmt man alle diese Stärken zusammen, so werden aber auch einige Schwachpunkte deutlich. Wer bloß an einer informativen Einführung oder an den wichtigsten Denkwegen zu Foucaults Werk und Leben interessiert ist, wird viele Abschnitte aus dem Buch als ungewohnt dicht, zu tiefgehend oder zu nah am Thema empfinden. Denn Watkin will mehr. Er fordert seine Leser trotz aller Kürze heraus, Foucault besser zu verstehen, die Dinge weiterzudenken und mit einer christlichen Antwort zu ringen. So gesehen mutet er seinen Lesern sehr viel mehr zu als nur eine Einführung, ohne jedoch das Potential darin ausschöpfen zu können.
Stellenweise wären noch einige kulturhistorische Ergänzungen interessant gewesen und die Beantwortung der Frage, weshalb Foucaults Impulse im 20. Jahrhundert eine solch große Wirkung entfalten konnten. Wieso war der französische Philosoph damals derart prominent und gern gehört? Stellenweise hätte Watkin auch noch etwas mehr Abstand wagen und noch stärker über die Foucaultschen Schlüsselthemen hinausgehen können. Der Brückenschlag von der Philosophie hin zur heutigen Kultur und zum echten Leben wird immer wieder skizziert, bleibt aber oft bei eher grundsätzlichen (wenngleich wertvollen) Überlegungen stehen. Oder anders gesagt: Die Lektüre wirkt zwischendurch, als säße man in einem hochmotorisierten Sportwagen, den man nur in den ersten beiden Gängen fahren darf.
Unerledigte Aufgaben und Steilvorlagen
Abschließend könnte man sagen: Die Schwächen des Buches ergeben sich aus seinen unzähligen Stärken und drängen zu einem multi-thematischen, biblisch-theologischen Gesamtentwurf. Hier empfiehlt sich Watkins beeindruckendes Hauptwerk Biblical Critical Theory, das im Jahr 2022 hohe Wellen geschlagen hat und ungewöhnlich stark rezipiert wurde. Gleichzeitig sollte man seine kurze Studie zu Foucault aber nicht unterschätzen – sie bietet eine intellektuelle Tiefenbohrung und ein Testfeld dafür, wie man heute eine biblische, kritische Theorie auf andere philosophische Entwürfe und Denkwege anwenden könnte.
Wer noch stärker historisch interessiert ist und sich fragt, wie der westliche Kulturkreis zu vielen seiner säkularen Überzeugungen gelangt ist, wird zu Carl Truemans Buch Der Siegeszug des modernen Selbst greifen wollen. Hier findet man eine intellektuell redliche, christliche Perspektive zu Fragen von Authentizität, Ästhetik und Identität. Wer darüber hinaus z.B. die Themen von Identität und Selbstbild für die Praxis weiterdenken will, wird mit Nancy Pearceys Liebe deinen Körper und mit Brian Rosners Buch zur Selbstfindung nichts falsch machen.
Wir leben in spannenden Zeiten. Der westliche Kulturkreis ringt unaufhörlich mit den Herausforderungen einer unperfekten Welt, oder besser, mit einer gefallenen Schöpfung. Christen tun heute gut daran, sich mit einflussreichen Denkern wie Michel Foucault zu beschäftigen, um die Gesellschaft, die eigene kulturelle Prägung und nicht zuletzt ihre Mitmenschen besser zu verstehen. Wahrheit, Macht und Identität sind keine abstrakten, lebensfernen Themen. Im Gegenteil, sie beschäftigen uns persönlich und uns als ganze Gesellschaft. Aber nicht nur das – sie weisen uns auch auf tiefe, existenzielle Fragen hin.
Woher sollen bleibende und wahre, gute und lebbare Antworten kommen? Christopher Watkin kehrt hierfür zu den Schätzen der Weisheit und der Erkenntnis zurück, die in Jesus Christus zu finden sind. Er durchdenkt und ringt damit und staunt letztlich, wie das Evangelium noch heute Menschen retten und verändern kann. Hier finden sich wahre Liebe und Gerechtigkeit, übersprudelnde Gnade und Wahrheit. Wer sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand dem dreieinigen Gott anvertraut, der hat sein Leben wahrlich nicht auf Sand gebaut.
Buch
Christopher Watkin, Michel Foucault, Great Thinkers, Bd. 5, Phillipsburg: P&R Publishing, 2018, 216 Seiten, ca. 14,50 EUR.