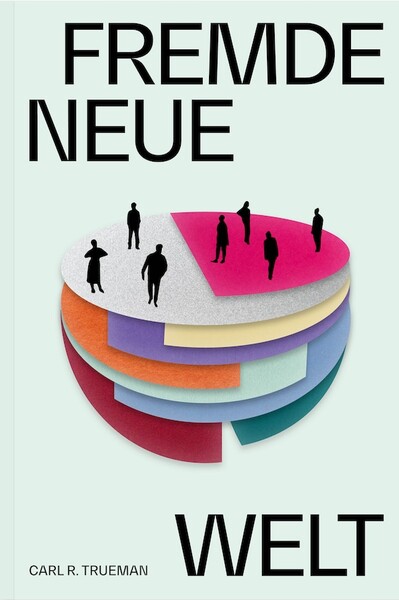
Fremde neue Welt
Das Eingeben von „fremde neue Welt“ in eine Suchmaschine führte mich zunächst zu der kürzlich erschienenen Science-Fiction-Serie „Strange New Worlds“ von Star Trek. In gewisser Weise ist das Star Trek-Universum das Gegenstück von dem, was Carl R. Trueman in seinem Buch beschreibt, nämlich nicht das Eröffnen einer fiktiven Welt unendlicher Weiten, sondern das Klären und Erhellen der realen Wirklichkeit, die einem aus der Perspektive früherer Generationen wie Science-Fiction vorkommen kann.
Carl R. Trueman, Professor für Bibel- und Religionswissenschaften am Grove City College in Pennsylvania (USA) und zuvor Professor für Kirchen- und Theologiegeschichte am Westminster Theological Seminary, legte 2020 ein vielbeachtetes Buch vor, welches 2022 auch in deutscher Sprache erschien: Der Siegeszug des modernen Selbst: Kulturelle Amnesie, expressiver Individualismus und der Weg zur sexuellen Revolution (Verbum Medien, 2022). Völlig zu Recht wird dieses Buch u.a. auch von der renommierten deutschen Professorin für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft der TU Dresden, Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, mit diesen Worten gelobt: „Das Buch ist eine Augenöffnung – somit ein großer Dienst in verwirrten Zeiten.“
Diese Einführung ist wichtig, um das vorliegende Buch Fremde neue Welt richtig einordnen zu können, denn es beruht auf der zuerst erschienen, rund 500 Seiten starken Studie. Aufgrund des Umfangs und des hohen Anspruchs wurde Trueman gebeten, das Ergebnis weiteren Lesern erneut auf „kürzere und (hoffentlich) zugänglichere Weise“ (S. 18) zugänglich zu machen. Das Fazit vorweg: Meiner Ansicht nach ist ihm dies auf beeindruckende Weise gelungen! Ich empfinde diese kürzere, teilweise zugespitztere Version für noch wirkmächtiger als sein ohnehin schon äußerst lesenswertes längeres Werk.
Was ist der Anlass?
Veränderungen hat es immer schon gegeben. Architektur, Kunst, Mode, politische und ökonomische Vorstellungen unterliegen jederzeit Bewegungen. Was sich jedoch innerhalb der vergangenen Jahrzehnte abgespielt hat und weiterhin abspielt, ist kein natürlicher Veränderungsprozess, sondern eine Revolution. Diese hat sich so geschickt vollzogen, dass die meisten Menschen sie sehr viel später – an den Auswirkungen des Kulturkampfes am Esstisch, am Arbeitsplatz oder bei Familientreffen – wahrnehmen, also erst dann, wenn die Revolution bereits vollzogen ist. „Willkommen in dieser fremden neuen Welt! Vielleicht gefällt sie Ihnen nicht. Aber Sie leben in dieser Welt und deshalb ist es wichtig, dass Sie versuchen, sie zu verstehen“ (S. 24).
„Was sich innerhalb der vergangenen Jahrzehnte abgespielt hat und weiterhin abspielt, ist kein natürlicher Veränderungsprozess, sondern eine Revolution.“
Die revolutionären Umwälzungen im sexualethischen Bereich hin zur LGBTIQ+-Bewegung seit den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts sind für Trueman lediglich die sichtbaren Auswirkungen eines viel tiefgreifenderen Prozesses, den es zu verstehen gilt. Nur wer die Wurzel versteht, kann auch überlegen, wie angemessen darauf zu reagieren ist. Daher untersucht Trueman den Begriff des „Selbst“, des „Ich als Individuum“. Biblisch gesprochen geht er damit der Frage von König David aus Psalm 8,5 nach: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ Trueman stellt fest:
„Das moderne Selbst geht von der Autorität innerer Gefühle aus und definiert Authentizität als die Fähigkeit, diesen Gefühlen gesellschaftlichen Ausdruck zu verleihen … Ein solches Selbst wird durch das bestimmt, was man expressiven Individualismus nennt.“ (S. 26)
Die Geschichte der Revolution
In den folgenden Kapiteln zeichnet er die Geschichte dieser Revolution nach, die schließlich zu einer ganz neuen – aus historischer Perspektive zu einer fremden neuen – Welt geführt hat. Trueman führt dabei als Symbol dieser neuen Welt den Transgenderismus an:
„Der Satz ‚Ich bin eine Frau, die in einem Männerkörper gefangen ist‘ wäre für meinen Großvater Unsinn gewesen. Hätte ein Patient dies in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu einem Arzt gesagt, hätte dieser mit ziemlicher Sicherheit geantwortet, dass er ein psychiatrisches Problem habe und eine Therapie brauche, um seine Gefühle mit seinem physischen Körper in Einklang zu bringen.“ (S. 39)
Für eine solche Aussage würden dem Arzt heute rechtliche und gesellschaftliche Konsequenzen drohen.
Um diesen Veränderungsprozess nachvollziehen zu können, schließt Trueman einen ideen- und kulturgeschichtlichen Durchgang an. Dieser beginnt beim französischen Mathematiker und Philosophen René Descartes (1596–1650) mit seinem „Ich denke, also bin ich“ und erhält einen entscheidenden Schub durch den Genfer Philosophen Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Rousseau prägte die Sicht „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“ (S. 50), die es bis hinein in die postmoderne Philosophie von Jean-François Lyotard und Jacques Lacan geschafft hat, Wirkung zu erzielen.
Die Nachwirkungen des Deutschen Idealismus schildert Trueman dann unter der Kapitelüberschrift „Entfesselter Prometheus“ und schildert darin die Veränderungen und Weiterführungen von Hegel über Marx zu Nietzsche. Eine zentrale Veränderung in dieser Zeit ist, dass gerade durch Marx „alle menschlichen sozialen Beziehungen auf ökonomische Verhältnisse zurückzuführen [sind, was] eine weitere wichtige Folge hat: Alle gesellschaftlichen Verhältnisse sind daher politisch zu betrachten, weil sie alle zur Erhaltung des Status quo dienen“ (S. 71). Daraus erklärt sich auch, warum die gesellschaftlichen Veränderungen heute primär auf politischer Ebene durchgesetzt und rechtlich sanktioniert werden sollen.
Zu dieser politisch-gesellschaftlichen Dimension kommt dann noch die psychologische, die in besonderer Weise durch Sigmund Freuds Arbeit sexualisiert worden ist:
„Die Bedeutung dieser Entwicklung, das sexuelle Begehren in den Mittelpunkt der menschlichen Identität zu stellen, kann kaum überschätzt werden. Vieles in der modernen Gesellschaft setzt dies voraus, von der gängigen Verwendung von Begriffen wie ‚heterosexuell‘ und ‚schwul‘ in Alltagsgesprächen bis hin zu den Grundannahmen der internationalen Menschenrechtsgesetze.“ (S. 92)
Die Verschmelzung der Strömungen
Der ursprünglich aus Österreich-Ungarn stammende Psychiater Wilhelm Reich (1897–1957) ist es dann, der mit seinen Forschungen die Verbindung zwischen den erst getrennt stehenden Theorien von Karl Marx und Sigmund Freud zusammenbringt. Reich kritisiert die Sexualmoral seiner Zeit und wirft ihr vor, die Struktur der traditionellen Familie zu stärken und in der Folge autoritären Personen und Strukturen gehorsam zu sein. Die vermeintlich enge Sexualmoral wird also mit dem Verständnisrahmen für politische Unterdrückung des Marxismus verbunden und zur sexuellen Revolution aufgerufen:
„Der Punkt ist klar: Sexuelle Normen müssen zerschlagen werden, wenn der Mensch wirklich frei sein soll. Alles, was die freie sexuelle Entfaltung behindert (selbst die von kleinen Kindern), ist repressiv und hindert den Menschen daran, wirklich er selbst zu sein.“ (S. 102)
Was also mit Reich in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt und in den 60ern zur vollen Tragweite kommt, ist Folgendes:
„Der politische Kampf verlagert sich jetzt selbst in den psychologischen Bereich: Unterdrückung beinhaltet nicht mehr nur den Mangel an materiellem Wohlstand oder körperlicher Freiheit, sondern erlangt eine psychologische Komponente.“ (S. 108)
Die Konsequenzen davon sind, dass sobald auch die Identität psychologisch gefasst wird, jede Kritik daran potentiell als Waffe angesehen werden kann, mit Folgen für die Religions- und Meinungsfreiheit.
Als weiteren, parallel verlaufenden Teil der Revolution stellt Trueman den Zusammenbruch traditioneller Autoritäten dar. Dieser hat ein Vakuum hinterlassen, welches von Theorien wie jenen von Wilhelm Reich gefüllt worden und durch die Versprechen einer sexuellen Freiheit als Inbegriff der Erfüllung begierig aufgenommen worden sind. Trueman zeichnet in groben Zügen die Geschichte der LGBTQ+-Bewegung von den 1960er-Jahren an nach und hebt dabei die besondere Rolle der französischen Philosophin Simone de Beauvoir hervor, der Partnerin von Jean-Paul Sartre. Differenzierend hält er fest:
„Dieser Gedanke [dass die Geschlechter nicht bloße Biologie, sondern auch soziales Konstrukt sind] hat durchaus etwas Wahres an sich. Jeder, der Erfahrungen mit verschiedenen Kulturen hat, weiß, dass die Geschlechterrollen auf der Welt nicht immer gleich sind.“ (S. 165)
„Doch von dieser recht offensichtlichen Realität hin zur Vorstellung, dass Geschlecht und Gender nichts miteinander zu tun haben und letzteres lediglich eine Vorstellung ist, ist ein dramatischer metaphysischer Sprung“ (S. 166), der so nur gelingen konnte, weil die zuvor geschilderten gedanklichen Prozesse in Bezug auf Identität und Sexualmoral bereits vollzogen worden waren.
Dass die LGBTQ+-Bewegung allerdings keine einheitliche Strömung und keineswegs frei von Widersprüchen ist, zeichnet Trueman anhand etlicher Belege und Selbstaussagen aus der Community und nicht zuletzt anhand des zunehmenden Disputs zwischen der Transbewegung und dem traditionellen Feminismus eindrücklich nach. Der letzte große Meilenstein für die Bewegung waren die 2006 ausformulierten Yogyakarta-Prinzipien, benannt nach der indonesischen Stadt der Zusammenkunft, die die Grundlage für viele Regierungen weltweit sind, Gesetze zur sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität zu verabschieden.
Die fremde neue Welt im 21. Jahrhundert
In den abschließenden zwei Kapiteln fasst Trueman die Herausforderung dieser Revolution noch einmal aus unterschiedlichen Perspektiven zusammen. Er macht deutlich, dass es ihm keineswegs um eine Diskriminierung einzelner Personen oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geht, sondern dass diese Revolution in den westlichen Ländern eine so starke Dimension eingenommen hat, dass er die modernen Freiheitsrechte der Rede- und Religionsfreiheit ernsthaft in Gefahr sieht:
„Als ich jung war, wurden gläubige Menschen von der Mehrheitskultur oft als dumm oder heuchlerisch angesehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Überzeugung weit verbreitet wäre, dass sie kollektiv als gefährliche, hasserfüllte Fanatiker gegolten hätten, die eine Bedrohung für die gesellschaftliche Ordnung darstellen.“ (S. 192)
Aufgrund einer jüdischen oder christlichen Überzeugung eine nicht-heterosexuelle Beziehung zu kritisieren oder auch nur als nicht gut anzusehen, wird weder gesellschaftlich noch inzwischen juristisch als legitim erachtet:
„An diesem Punkt werden Religionen in Schwierigkeiten geraten, insbesondere solche wie das Christentum und Judentum, die sich an strenge Regeln bezüglich Sex und Sexualität halten, weil sie sich in einer Welt wiederfinden, die mit einer anderen ‚Grammatik‘ von Identität operiert.“ (S. 198)
In besonderer Weise dramatisch sichtbar werden die Folgen an den Hochschulen, wofür Trueman einige Beispiele von US-Universitäten anführt, die sich aber auch durch aktuelle deutsche leicht ergänzen ließen. Durch die Theorien der sogenannten Neuen Linken und insbesondere durch den deutsch-amerikanischen Philosophen Herbert Marcuse ist eine Zensur von Meinungsäußerungen eingezogen mit der Absicht, die Gesellschaft gerechter und gleicher zu machen, die schließlich gerade an Universitäten, dem eigentlichen Ort von Bildung und Debatte, zu einer Cancel Culture bis hin zu gewaltsamen Vorfällen geführt haben.
„Das Problem ist allerdings, dass das Ziel dieser Auseinandersetzungen nicht ist, den [Bildungs]Kanon zu erweitern, sondern ihn zu ersetzen, oder besser gesagt, gar keinen Kanon mehr zu haben, weil das Konzept schon an sich ausgrenzend und repressiv sei.“ (S. 207)
Wege zum Leben in der fremden neuen Welt
Trueman möchte allerdings keineswegs mit einem pessimistischen Ausblick schließen, sondern hält fest:
„Die Welt, in der Religionsfreiheit und selbst Meinungsfreiheit von manchen (vielen?) als Problem für eine freie Gesellschaft angesehen werden statt als deren Grundlage, ist in der Tat eine fremde neue Welt. Aber so seltsam und neu sie auch ist, sie ist auch unsere Welt und wir müssen auf sie eingehen.“ (S. 210)
Seiner Überzeugung nach beginnt es damit, dass Christen sich selbst und als Kirchengemeinden anfangen zu fragen, wo sie durch den Zeitgeist bedingte Kompromisse am Evangelium eingegangen sind. Dieser erste Schritt der Aufdeckung von Schuld und die darauffolgende Umkehr und Buße ist der Anfang. Im zweiten Schritt folgt eine Kultur der Demut, sodass Christen nicht zum Pharisäer aus Lukas 18,11 werden, der heuchlerisch dafür dankt, nicht so zu sein wie die anderen. Dies ist wichtig für den dritten Schritt der Selbstdisziplin und der Verbindlichkeit.
Für Christen gilt es, sich wieder neu auf die Alte Kirche zu besinnen, also auf die Christen der ersten Jahrhunderte:
„Damals war das Christentum eine unverstandene, verachtete, randständige Sekte. Es wurde verdächtigt, unmoralisch und aufrührerisch zu sein. Der Verzehr von Fleisch und Blut ihres Gottes und die Anrede ‚Bruder‘ und ‚Schwester‘, selbst wenn man verheiratet war, ließen die Christen und ihren Glauben für Außenstehende höchst zweifelhaft erscheinen.“ (S. 220)
Auch wenn Trueman eingesteht, dass die Analogie natürlich nicht perfekt ist, so gibt es doch erstaunliche Ähnlichkeiten in der Situation des Christentums inmitten einer heidnischen, postchristlichen Welt. Wenn wir uns mit der Alten Kirche von der Apostelgeschichte an beschäftigen, sehen wir: „Christliche Identität war eindeutig sehr praktisch, bodenständig und alltagsorientiert“ (S. 221).
Kein Kulturkampf, sondern eine überzeugende Alternative
Daher sollten sich Christen auch nicht in einen Kulturkampf hineinziehen lassen, sondern schlicht die Gemeinschaft untereinander organisieren und lebendig gestalten: „Das mächtigste Zeugnis für das Evangelium ist die Kirche selbst, wenn sie einfach ihre Gottesdienste hält und Gott anbetet“ (S. 222f). Gerade durch diese Gemeinschaft der Christen kann der gegenwärtigen Kultur eine Alternative angeboten werden, die in der Anbetung Gottes gründet und sich im liebevollen Miteinander zeugt und bewährt. Trueman verweist auf die frühkirchlichen Apologeten wie Justin den Märtyrer oder den Kirchenvater Augustinus. Diese riefen die Christen angesichts einer feindlichen Kultur dazu auf, konstruktive Mitglieder in ihrer Gesellschaft zu sein und gerade durch ihre Lebensführung Zeugnis einer besseren Alternative zu sein.
„Christen sollten sich nicht in einen Kulturkampf hineinziehen lassen, sondern schlicht die Gemeinschaft untereinander organisieren und lebendig gestalten.“
Schließlich kommt Trueman zu dem Punkt, dass die Kirchen der Reformation das Naturrecht sowie eine „Theologie des Leibes“ wiederentdecken müssen. Diese sind in der römisch-katholischen Kirche verankert, wenn auch in der westlichen Welt nicht minder umkämpft. Es geht dabei um die Überzeugung: „Unser Körper ist kein Gefäß, das wir nur bewohnen und beleben. Er ist in tiefer und bedeutsamer Weise integraler Bestandteil unserer Identität, unseres Selbst“ (S. 230). Diese Überzeugung steht einer modernen Trennung von Körper und Geist entgegen und gilt es daher wieder neu zu durchdenken und in der Konsequenz zu lehren.
Trueman fasst seine Ergebnisse sehr treffend selbst zusammen:
„Schließlich sollte sich die Kirche in ihrer Reaktion auf die gegenwärtige Zeit weder zu Verzweiflung noch zu Optimismus hinreißen lassen. Ersteres hieße, die Verheißung nicht ernst zu nehmen, dass die Kirche am Ende siegreich dastehen wird, weil die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Letzteres bedeutet einfach, die Weichen für eine tiefere Verzweiflung zu stellen, die sich dann später einstellt. Beide Sichtweisen führen letztlich zu Untätigkeit, die eine aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, die andere wegen ihrer Naivität.“ (S. 233)
Wie er bereits zu Beginn seines geschichtlichen Durchgangs deutlich gemacht hat, geht es ihm darum, dass die Christen die Kultur ihrer Zeit verstehen, um darauf angemessen reagieren zu können. Darum schließt er mit dem Aufruf:
„Dies ist weder die Zeit für hoffnungslose Verzweiflung noch naiven Optimismus. Ja, lasst uns die verheerenden Folgen des Sündenfalls beklagen, die sich nun auf die spezifische Weise zeigen, die sich unsere Generation ausgesucht hat. Lasst uns die Klage zugleich zum Anlass dafür nehmen, unsere Identität als Volk Gottes und unseren Hunger nach der großen Vollendung zu stärken, die uns bei der Hochzeit des Lammes erwartet.“ (S. 235)
Zusammenfassendes Fazit
Wenn man das Buch von Carl R. Trueman ohne die Einleitung und das Schlusskapitel lesen würde, hätte man lediglich eine deprimierende Entwicklungsgeschichte vor Augen, die Christen in eine Verzweiflung treiben und zur Flucht in die Science-Fiction antreten lassen könnte. Doch gerade eine solche kulturpessimistische Perspektive will Trueman nicht geben. Im Gegenteil! Er möchte wachrütteln, erklären und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es dringend geboten ist, dass Christen ihre Identität als Kinder Gottes stärken, unabhängig von gesellschaftlichen Wertmaßstäben, und gemeinsam ein überzeugendes Alternativmodell anbieten, welches Gott ehrt und ein sichtbares Abbild eines erlösten Volkes Gottes ist.
Das Buch Fremde neue Welt ist daher, wenn auch leicht verständlich, keineswegs leichte Kost. Die Beschäftigung damit wird für den Einzelnen und gerade im Austausch innerhalb christlicher Gemeinden (hoffentlich) eine heilsame Wirkung erzielen.
Buch
Carl R. Trueman, Fremde neue Welt: Wie revolutionäre Denker Identität und Sexualität verstehen, Bad Oeynhausen: Verbum Medien, 2023, 254 Seiten, 16,90 EUR.
Das Buch kann auch direkt beim Verlag bestellt werden.