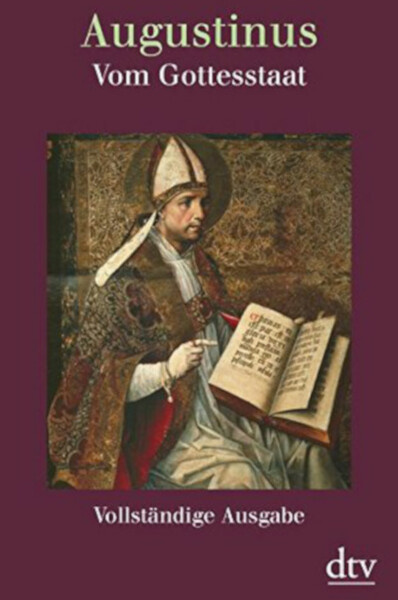
Vom Gottesstaat
Kommen dir folgende Einschätzungen bekannt vor?
- Die Gesellschaft ist in entgegengesetzte Parteiungen gespalten, die nichts anderes tun, als sich gegenseitig anzuschreien.
- Hinter einer selbstgefälligen Rhetorik von Freiheit und Offenheit verbirgt sich eine dogmatische, autoritäre Forderung nach Verehrung der Götter unserer Zeit.
- Politische und ökonomische Kräfte verschwören sich, um einen Lifestyle für die Elite zu erhalten.
- Eine Gesellschaft, die von sich selbst behauptet, den Aberglauben hinter sich gelassen zu haben und endlich „auf der richtigen Seite der Geschichte“ zu stehen, fällt an anderer Stelle einem seltsamen Aberglauben und altertümlichen Ansichten anheim.
Willkommen im Rom des 5. Jahrhunderts. Willkommen in der komplexen, wankenden, geteilten und widersprüchlichen Gesellschaft, in der Augustinus sein berühmtes Werk der sozialen und politischen Theorie schrieb: De civitate Dei (Vom Gottesstaat). Die Abhandlung des Bischofs von Hippo bietet einen packenden Urtypen einer Kulturkritik, der immer noch Gültigkeit beansprucht.
Im Folgenden schauen wir uns sechs Werkzeuge aus Augustinus’ Meisterwerk an, die uns helfen können, unseren Umgang mit der modernen Kultur zu vertiefen und entwickeln.
1. Sei ein „Insider“-Außenseiter.
Augustinus hat nicht einfach nur einen kurzen Abriss über die spätrömische Kultur gelesen. Er kennt die Kultur von innen heraus – und das merkt der Leser. Er hat in Karthago und Rom Vorlesungen über Rhetorik gehalten und kann Cicero mit echter Bewunderung zitieren. Er schreibt nicht lediglich über die römische Kultur, um sie dann von oben herab zu verhöhnen. Er versteht, warum sie für diejenigen, die sie für sich beanspruchen, so attraktiv erscheint.
Trotzdem ist Augustinus auch ein Außenseiter. Ja, er ist aus Nordafrika, aus Tagaste im heutigen Algerien. Ja, er hat eine christliche Mutter und einen heidnischen Vater, aber was ihn zum Außenseiter der römischen Kultur macht, ist seine Treue zu Jesus Christus.
Wir neigen heutzutage im Hinblick auf kulturelles Engagement häufig dazu, zwischen dem „einfühlsamen Insider“ und dem „tapferen Außenseiter“ zu unterscheiden. Augustinus zeigt uns, wie wichtig es ist, beide Aspekte zu vereinen.
2. Setz dich kritisch mit der gesamten Kultur auseinander.
Augustinus bewertet nicht nur gewisse Einzeltrends innerhalb der spätrömischen Kultur. Stattdessen behandelt er ihre tiefen Strukturen und ihre grundlegenden Annahmen: ihre Tugenden wie auch die Laster, ihre Frömmigkeit wie auch die Philosophie, ihr politisches Umfeld und auch die Unterhaltung des Volkes. Vom Gottesstaat ist kein paramilitärisches Sondereinsatzkommando, das ein bestimmtes kulturelles Schreckgespenst bekämpft. Es ist stattdessen die Sozialarbeit, die die römische Gesellschaft in ihrem ganzen Ausmaß erfasst. So etwas hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Der Augustinus-Forscher Charles Mathewes merkt an, dass Vom Gottesstaat einen „sehr entscheidenden Moment in der Entwicklung dessen“ darstellt, „was wir eine kritische Haltung gegenüber einem unreflektierten Leben in einer gegebenen sozialen Welt nennen können“. Mit anderen Worten: Alle umfassenden sozialen und kritischen Theorien haben ihre Wurzeln bei Augustinus.
3. Setz dich kritisch anhand der gesamten Bibel auseinander.
Augustinus setzt sich mit der römischen Kultur nicht etwa mit isolierten Bibelversen oder einigen Lieblingslehren auseinander. Die Bücher 11–20 aus Vom Gottesstaat durchleuchten systematisch die gesamte Schrift von der Schöpfung bis zur Offenbarung, um zu zeigen, dass die Bibel eine kohärente und überzeugende Alternative zu Roms wirren Glaubensvorstellungen bietet.
Die Bibel kann überzeugend für sich selbst sprechen, indem sie die eigenen Schwerpunkte auf ihre eigene Art und Weise präsentiert, anstatt sich in eine kulturelle Schublade zwängen lassen zu müssen. Bei Augustinus dreht sich nicht alles nur um das Thema Schöpfung, die Sünde oder gar nur um die Erlösung, wie es bei einigen modernen Ansätzen der Fall ist. Seine Kulturkritik bewahrt ein biblisches Gleichgewicht.
4. Schau unter die Oberfläche.
Die Kulturkritik von Augustinus ist nicht oberflächlich. Er begnügt sich nicht mit einer Analyse dessen, was die römische Kultur über sich selbst behauptet. Vielmehr will er zum inneren Kern der Dinge vordringen, um aufzudecken, was unter der Oberfläche geschieht.
„Augustinus schreibt von einem ruhmreichen Christus, der sich selbst entleert und dient, nicht von einem ruhmreichen Cäsar, der sich selbst erhöht und andere versklavt.“
Für Augustinus ist der Schlüssel seiner tiefgehenden Analyse die Liebe: Zwei Städte sind durch zwei unterschiedliche Arten von Liebe entstanden – die Liebe zu Gott und die Selbstliebe. In der Tat geht die Liebe tiefer als Ideen. So schreibt Augustinus: „Wo immer der Leib hingeht, da wird er von seinem Gewicht getragen. So wird auch die Seele getragen von ihrer Liebe.“ Wann immer Augustinus auf ein kulturelles Gedankengut, eine kulturelle Praxis oder Haltung stößt, fragt er reflexartig: „Welche Liebe kommt darin zum Ausdruck?“ Was für eine entscheidende Frage, mit der wir uns mit der heutigen Kultur auseinandersetzen können!
5. Widerstehe einer falschen Gegenüberstellung von Gegensatz und Erfüllung.
Augustinus vermeidet den doppelten Fallstrick, die beiden Städte entweder nur rein gegensätzlich zu sehen oder nur zu sehen, wie die Stadt Gottes die tiefsten Sehnsüchte der irdischen Stadt erfüllt. Auch vermeidet er einen faulen Kompromiss, den Unterschied zwischen Gegensatz und Erfüllung aufzuspalten.
Diese außergewöhnliche Strategie kommt gleich in den ersten Worten des Buches zum Ausdruck, dort benennt Augustinus den „ruhmreichen Gottesstaat“. „Ruhmreich” war ein charakteristisch römischer Wert. Das ruhmreiche Rom fand seinen Ausdruck darin, wie es seine Feinde eroberte und vernichtete. Dieser Ruhm war wohl kaum eine christliche Tugend.
Wenn Augustinus heute ein Buch schriebe, dann würde es womöglich mit „Christen sind von allen Menschen am meisten emanzipiert“ oder „Mein Gott ist viel woker als du!“ beginnen. Für manche Menschen ist so eine Sprache eine klare Grenzüberschreitung: „Du bist vor der dich umgebenden Ideologie eingeknickt, Augustinus! Du kannst so ein Wort [gemeint ist „ruhmreich“; Anm.d.Übers.] nicht benutzen – es ist unnötig provokant und möglicherweise gar irreführend. Hör auf, dich mit den Römern gemein zu machen, und komm aus ihrer Mitte heraus!“
Solche Einwände vergessen aber, dass Augustinus’ Definition von Ruhm gegensätzlich zur römischen Definition war. Er schreibt von einem ruhmreichen Christus, der sich selbst entleert und dient, nicht von einem ruhmreichen Cäsar, der sich selbst erhöht und andere versklavt. Die Berufung auf den Ruhm ist ein brillanter Schachzug, der zwei Dinge gleichzeitig bewirkt. Er stellt die Stadt Gottes als die tiefste, wahrhaftigste Verwirklichung all dessen dar, was Rom lieb und teuer ist. Dies impliziert aber auch, dass die römische Vorstellung von Ruhm eine verdrehte Vorstellung ist.
Vom Gottesstaat folgt einem biblischen Muster. In 1. Korinther 1 präsentiert Paulus die Torheit Gottes sowohl als radikalen Gegensatz zur weltlichen Weisheit (vgl. 1Kor 1,20–23) als auch als tiefe Erfüllung all dessen, wonach die Weisheit strebt (vgl. 1Kor 1,25; 30–31). Wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir das Evangelium als Gegensatz oder als Erfüllung verkünden wollen.
6. Berücksichtige die komplexe Beziehung zwischen Kirche und Kultur.
Die letzte Lektion, die Augustinus uns erteilt, besteht darin, wie er die Stadt Gottes und die irdische Stadt in der heutigen Zeit als miteinander verflochten und untrennbar darstellt, gleichzeitig aber aufzeigt, dass sie dazu bestimmt sind, beim letzten Gericht getrennt zu werden. Ein kulturkritischer Ansatz, der die Gegensätze überbetont, würde dazu tendieren, die zwei Städte als vollständig voneinander getrennt zu betrachten – und wäre somit blind für die Art und Weise, wie die Kirche von der Kultur geprägt wird. Ein Ansatz, der die Erfüllung überbetont, würde dazu neigen, die beiden Städte letztlich als alternative Ausdrucksformen derselben grundlegenden Werte zu sehen – und wäre damit unfähig, der Welt eine wirkliche Alternative zu präsentieren – etwas, das mehr ist als eine bloß gestrichene Replik ihrer selbst.
„Vom Gottesstaat liefert einen Entwurf für ein kulturelles Engagement in unserer heutigen Zeit, das sowohl bibeltreu wie auch kultursensibel ist.“
Der biblische Rahmen in der Untersuchung von Augustinus bedeutet, dass er sich nicht zwischen zwei unzureichenden Optionen entscheiden muss. Die Verflechtung der beiden Städte in der heutigen Zeit hilft uns zu erkennen, dass „Kultur“ nicht etwas ist, das brav vor der Kirchentür sitzt und darauf wartet, hereingelassen zu werden. Kultur formt uns auch innerhalb der Kirche, ob wir wollen oder nicht. Und die getrennten Schicksale der beiden Städte erinnern uns daran, dass, so bequem sich die spätmodernen Annahmen auch anfühlen mögen (und wir machen uns etwas vor, wenn wir glauben, dass wir nicht Menschen der Moderne sind), sie nicht unser Zuhause sind und wir bereit sein müssen, sie zu kritisieren.
Vom Gottesstaat liefert einen Entwurf für ein kulturelles Engagement in unserer heutigen Zeit, das sowohl bibeltreu als auch kultursensibel ist. Seine Brillanz ist oft nachgeahmt, aber noch nie übertroffen worden.
Buch
Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat, dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2007, 1712 Seiten, ca. 25 Euro.