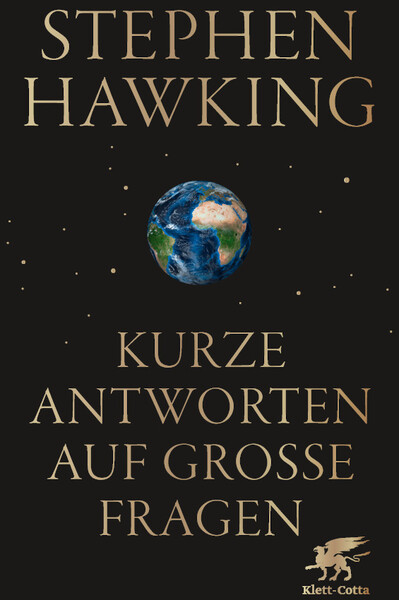
Kurze Antworten auf große Fragen
„Wer wissen will, woher wir kommen, wohin wir gehen und was der Sinn unseres Lebens ist, kommt in diesem letzten Buch des Astrophysikers Stephen Hawking auf seine Kosten.“
Dieses Zitat eines Journalisten auf dem Buchdeckel lässt den Leser voller Hoffnung zum „Spiegel-Bestseller“ greifen, um Antworten von einem der bekanntesten wissenschaftlichen Experten zu erhalten. Stephen Hawking war weltberühmt. Sein Leben wurde verfilmt, und er brachte es sogar zu einem Gastauftritt bei den Simpsons. Zeit seines Lebens war er bekannt dafür, seine immer schwerere Erkrankung zu ertragen. Dank technischer Hilfsmittel arbeitete er weiter und lebte mit Freunden und Familie zusammen. Seit seinem Welterfolg Eine kurze Geschichte der Zeit (1988) war seine Meinung auch zu Themen gefragt, die über seine Expertise als Kosmologe hinauszugehen scheinen.
Das Buch
Stephen Hawking starb 2018, während das Buch entstand. Wir wissen daher nicht, welche Teile er noch selbst freigegeben hat und welche ohne sein Zutun aus seinem Archiv in Zusammenarbeit mit Kollegen und Familienmitgliedern entstanden sind. Der Schauspieler Eddie Redmayne, der Nobelpreisträger und Physiker Kip S. Thorne und seine Tochter, die Autorin Lucy Hawking, liefern Vorwort, Einleitung und Nachwort. Dieser literarische Rahmen bringt uns den Menschen Stephen Hawking näher: seinen Charakter, seine Brillanz als Wissenschaftler sowie die große Achtung, die ihm von der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde. Damit erfüllen diese Beiträge die Aufgabe, die Autorität und Glaubwürdigkeit des Autors zu stärken. Das Buch präsentiert sich als das Vermächtnis eines berühmten, intelligenten, erfolgreichen, authentischen, liebevollen, tapferen, humorvollen, neugierigen und vorbildlichen Menschen.
„Hawkings Zugang zum Leben ist allein die theoretische Physik.“
Im Kapitel „Warum wir die großen Fragen stellen müssen“ beschreibt Stephen Hawking seinen Werdegang. Sein Zugang zum Leben ist allein die theoretische Physik. Trotzdem ist ihm, auch aufgrund seiner Erkrankung klar, dass das Leben ohne Liebe und andere Menschen keine Bedeutung hätte. Hawking fordert uns auf, die Menschheit im Angesicht existenzieller Bedrohungen zu schützen: „Seid tapfer, neugierig, entschlossen und überwindet alle Widrigkeiten! Wir können es schaffen!“ (S. 47).
Die großen Fragen
Die zehn Kapitel, die jeweils einer großen Frage und ihrer kurzen Antwort gewidmet sind, sollen hier noch kürzer zusammengefasst werden:
„1. Gibt es einen Gott?“ steht im Zeichen der Konfliktthese: Es gibt einen „Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Religion“ (S. 52). Die Naturwissenschaft ist rational. Sie entdeckt universelle und unveränderliche Naturgesetze, die erklären, warum die Welt begann und wie sie sich entwickelt. Für den christlichen Gott, der persönlich eingreift, bleibt kein Ort (es gibt nichts außerhalb des Universums), keine Zeit (vor dem Urknall gab es keine Zeit) und keine Möglichkeit einzugreifen (die Naturgesetze können nicht gebrochen werden).
„2. Wie hat alles angefangen?“ erklärt, dass es noch „kein vollständiges Bild“ gibt (S. 66). Dennoch ist für Hawking klar: „Wir sind das Produkt von Quantenfluktuation im ganz frühen Universum“ (S. 86). Diese Quantenfluktuationen waren „die Keime für Strukturen in unserem Universum“ (S. 85). Interessant sind Hawkings Ausführungen zur anfänglichen Ablehnung von Urknallmodellen aufgrund atheistischer Grundannahmen.
„3. Gibt es anderes intelligentes Leben im Universum?“ definiert Leben und skizziert die evolutionäre Entwicklung der Menschheit bis zur derzeitigen Phase: „Wir werden in der Lage sein, unsere DNA selbst zu verändern und zu verbessern“ (S. 104). Schließlich werden die neuen Menschen den Weltraum besiedeln. Wenn das bei uns so schnell geht, fragt Hawking: „Warum wimmelt es also in unserer Galaxis nicht von Lebensformen …?“ (S. 107). Entweder konnte das Leben nur auf der Erde entstehen, andere Lebensformen entwickelten keine Intelligenz, Asteroideneinschläge beenden überall (außer bei uns) die Entwicklung, intelligentes Leben zerstört sich immer selbst oder wir wurden bisher zum Glück einfach übersehen.
„4. Können wir die Zukunft vorhersagen?“ behauptet, Gott oder Götter seien aufgrund des wissenschaftlichen Determinismus für die Erklärung von Phänomenen nicht mehr nötig. Im Prinzip ist die Zukunft vorhersagbar, allerdings geht das praktisch nicht, und zwar wegen der Komplexität und aufgrund chaotischer Eigenschaften der nötigen Berechnungen, der Unschärferelation und unerkennbaren Regionen in Schwarzen Löchern.
„5. Was befindet sich in einem schwarzen Loch?“ informiert über Forschungsgeschichte und Eigenschaften zu dem von Hawking am meisten beforschten Gebiet. Das Informationsparadox führte Hawking zu Überlegungen, die über Masse, Drehimpuls und elektrische Ladung hinaus Informationen auf dem Ereignishorizont des Schwarzen Lochs annehmen lassen.
„6. Sind Zeitreisen möglich?“ schließt Zeitreisen prinzipiell nicht aus, erklärt aber, dass dafür entweder unendliche Energie oder die Konstruktion eines Wurmloches nötig wären. Ein Gegenindiz sieht Hawking darin, dass wir keine Zeitreisenden aus der Zukunft treffen. Da Zeitreisen mit Paradoxa verbunden sind, vermutet er, dass die Gesetze der Physik sie nicht erlauben.
„7. Werden wir auf der Erde überleben?“ verneint klar: Es gibt angesichts der Bedrohungen durch Asteroiden, Atomkriege und Umweltkatastrophen keine Zukunft auf der Erde. Der Planet wird im nächsten Jahrtausend verheert werden. Daher muss die Menschheit die Erde verlassen. Das könnte gelingen, denn die Veränderungen in Gesellschaft, Denken und Technologie werden aufgrund unserer beschleunigten Evolutionsrate rasant zunehmen.
„8. Sollten wir den Weltraum besiedeln?“ führt dieses Thema fort. Hawking skizziert eine Zukunft mit Stützpunkten auf Mond, Mars und den äußeren Planeten. Träume werden wahr – er berichtet von seinem eigenen Parabelflug und dem „Breakthrough Starshot“-Projekt mit seinen 1.000 miniaturisierten Satelliten. Nur im Weltraum liegt Hoffnung: „Eine andere Wahl haben wir nicht“ (S. 204).
„Hawking skizziert eine Zukunft mit Stützpunkten auf Mond, Mars und den äußeren Planeten.“
„9. Wird uns künstliche Intelligenz überflügeln?“ warnt vor ungezügelten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese hat viele Vorteile und wird sicher weiterentwickelt werden, bis sie menschliche Intelligenz weit übertrifft. Gefahren gehen dabei nicht nur von autonomen Waffen oder Handelssystemen aus. Die Menschheit muss Weisheit entwickeln und auf künstliche Superintelligenz vorbereitet sein. Deshalb engagierte sich Hawking in verschiedenen Institutionen für Technologiefolgenabschätzungen.
„10. Wie gestalten wir unsere Zukunft?“ betont die Wichtigkeit von Bildung und Phantasie. Beide sind bedroht. Die kommende Generation braucht gute Kenntnisse der Naturwissenschaft: „So kann sie später ihr Potenzial entfalten und eine bessere Welt für die gesamte Menschheit hervorbringen“ (S. 233). Hawking schließt mit dem Appell, neugierig zu sein, nicht aufzugeben und die Zukunft zu gestalten.
Die Frage nach Gott und das Weltbild des Kosmologen
Gott ist das wichtigste und am häufigsten angesprochene Thema des Buches. Bereits als Schüler war Stephen Hawking davon fasziniert und diskutierte über Gott. Sein vom materialistischen Determinismus geprägtes Weltbild bringt ihn aber dazu, die Existenz Gottes abzustreiten.
Die Konfliktthese: Wegen der Naturwissenschaft gibt es keinen Gott
Einleitung und Nachwort mögen noch ein zweideutiges Bild zeichnen: Redmayne hofft, „Stephen hat jetzt Spaß ‚da droben mitten unter den Sternen‘“ (S. 12), während Lucy Hawking schon als Kind einen Geistlichen durch herausfordernde Fragen bezüglich seines Gottesbeweises zum Weinen brachte. Ihr Vater Stephen Hawking selbst ist ebenfalls recht klar und behauptet, es gebe keinen Gott, wie Christen ihn sich vorstellen: „Meiner Ansicht nach lautet die einfachste Erklärung, dass es keinen Gott gibt. Niemand hat das Universum geschaffen und niemand lenkt unsere Geschicke“ (S. 62). Menschen denken bei Gott „an ein menschenähnliches Wesen, zu dem sie eine persönliche Beziehung unterhalten können. Eine Annahme, die höchst unwahrscheinlich ist, wenn Sie sich die ungeheure Größe des Universums anschauen und bedenken, wie unbedeutend und zufällig menschliches Leben im Universum ist“ (S. 52).
„Falls Hawking einen Grund dafür kannte, von der Größe des Universums auf die Unmöglichkeit eines persönlichen Gottes zu schließen, hat er ihn uns vorenthalten.“
Falls Hawking einen Grund dafür kannte, von der Größe des Universums auf die Unmöglichkeit eines persönlichen Gottes zu schließen, hat er ihn uns vorenthalten. Welche Argumente bringt er dann für seine These vor? Die Existenz Gottes widerspricht aus Hawkings Sicht der Wissenschaft. Seine Sicht auf die Wissenschaft lässt für Gott keinen Platz, keine Zeit und keine Möglichkeit zum Eingreifen. Der christliche Gott, der transzendent ist und immanent handelt, wird ausgeschlossen.
Warum gibt es die Religion dann immer noch?
Menschen werden sich weiter an die Religion „klammern, weil sie Trost spendet und weil sie der Wissenschaft nicht trauen oder sie nicht verstehen“ (S. 49). Viele Gläubige in der Spitzenforschung[1] könnten Hawking hier widersprechen. Doch selbst wenn sie vornehm dazu schweigen, widerlegt ihre Existenz Hawkings Aussage: Diese Forscher und Experten verstehen die Wissenschaften und halten trotzdem an ihrem Glauben fest. Womöglich besteht der krasse Konflikt zwischen Religion und Glaube gar nicht?
Wie ist die Wissenschaft entstanden?
Die Konfliktthese hat auch Auswirkungen auf Hawkings Version der Entstehungsgeschichte der Naturwissenschaft. Gläubige weisen gern auf den Ursprung der Naturwissenschaft innerhalb der christlichen Weltanschauung hin.[2] Hawking setzt um 300 v.Chr. mit Aristarch von Samos an, der ein „wissenschaftlicher Pionier“ (S. 50) war: „Nach einem sorgfältigen Studium des Himmels gelangte er zu einer mutigen Schlussfolgerung: Er hatte erkannt, dass die Finsternis in Wirklichkeit der Schatten der Erde war, der über den Mond wanderte, also kein göttliches Ereignis sich vollzog“ (S. 50). Hier leuchtet wieder die Konfliktthese auf: Entweder ist eine Mondfinsternis ein natürliches oder ein göttliches Ereignis – in Wahrheit schließen beide Perspektiven einander nicht aus. Hawking legt nahe, dass hier die Naturwissenschaft entstand – es geht bei ihm dann mit Einstein weiter. Die Jahrhunderte dazwischen überspringt er. Aristarch, so scheint es, hat alles schon erkannt: „Wie erstaunlich muss diese Erkenntnis gewesen sein: Das Universum ist eine Maschine, die bestimmten Prinzipien oder Gesetzen gehorcht … diese Naturgesetze – wie wir sie heute nennen – zeigen uns, ob wir einen Gott brauchen, um das Universum zu erklären“ (S. 51).
Woher kommt alles?
Wenn die „Maschine“ da ist und läuft, dann können wir erklären, was in ihr passiert. Das erklärt aber nicht, woher die Maschine kommt oder was passiert, wenn jemand in sie eingreift. Dieses Eingreifen scheint für Hawking unvorstellbar zu sein: „Im Tennis fliegt der Ball immer genau dorthin, wo er nach der Vorhersage der Gesetze landen muss“ (S. 51–52). Das stimmt aber nicht: Da der Wind weht, wo er will, und Vögel, Gegner oder Balljungen manchmal eingreifen, landet der Ball eben nicht immer dort, wo ihn die Vorhersage sieht. Die springende Frage: Ist das Universum offen für Eingriffe? Nein, antwortet Hawking ganz klar. Der Grund dafür ist: Die Naturgesetze gelten immer und überall. Sie können „nicht gebrochen werden – daher sind sie so mächtig und vom religiösen Standpunkt aus betrachtet so brisant“ (S. 52). Gott kann für Hawking zwar die Gesetze erlassen haben, „aber er kann nicht eingreifen, um die Gesetze zu brechen, andernfalls wären es keine Gesetze“ (S. 53). Hängt Gottes Handlungsspielraum wirklich von der Semantik des Wortes „Gesetz“ ab? Sicher nicht. Für Hawking spielt noch ein tieferes Prinzip eine Rolle: „Ich denke, das Universum ist spontan aus nichts entstanden, aber ganz in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Dabei ist die physikalische Grundannahme der wissenschaftliche Determinismus“ (S. 53).
Woher kommt diese Grundannahme des Determinismus?
Das bleibt offen. Allerdings erwähnt Hawking in seinem Werk ein starkes Motiv, an dieses „Dogma“ (S. 115) zu glauben: Heisenbergs Unschärferelation und der Informationsverlust in Schwarzen Löchern stören das Festhalten am wissenschaftlichen Determinismus. Und wenn er dort nicht mehr gilt, „dann könnte der Determinismus auch in anderen Situationen seine Geltung verlieren“ (S. 142). Was wäre daran problematisch? „Schlimmer noch – gilt der Determinismus nicht mehr, könnten wir auch unserer Geschichte nicht mehr sicher sein. Die Geschichtsbücher und unsere Gedächtnisse könnten reine Illusionen sein. Die Vergangenheit teilt uns mit, wer wir sind. Ohne sie verlieren wir unsere Identität“ (S. 143). Das Festhalten am Determinismus könnte also dem psychologischen Motiv entspringen, die Geschichte und die eigene Identität nicht zu verlieren. Doch ist das der Fall? Werden wir durch stures Festhalten am Determinismus nicht gerade daran gehindert, die Geschichte wahrhaftig zu erkennen, wenn Gott an bestimmten Punkten eingegriffen haben sollte – wie Christen es zum Beispiel bei der Auferstehung annehmen?[3] Und überhaupt: Werden wir unsere Geschichte und unsere Identität verlieren, wenn wir zugestehen, dass Gott jederzeit souverän in die von ihm geschaffene Welt eingreifen kann? Das wäre nur der Fall, wenn Gott kapriziös und böse wäre und uns laufend über unsere Geschichte täuschen wollte.
„Da Gott uns Menschen als seine Ebenbilder geschaffen hat, können wir mit unserem Verstand die Welt wahrnehmen. So wird Naturwissenschaft erst möglich.“
Der Gott, der sich in der Bibel offenbart, stellt sich aber gerade als treu und zuverlässig dar. Seine Treue beweist er darin, dass er zum Wohl der Menschen eingreift. Seine Treue beweist er auch darin, die Welt zu erhalten und ihr geordnete Bahnen zu ermöglichen. Da Gott uns Menschen als seine Ebenbilder geschaffen hat, können wir mit unserem Verstand die Welt wahrnehmen. So wird Naturwissenschaft erst möglich. Dazu passt, dass die moderne Naturwissenschaft innerhalb der biblischen Weltanschauung entstand und vor allem von Gläubigen entwickelt wurde. Der Historiker Tom Holland bringt es auf den Punkt: „‚Die Heilige Schrift‘, so schrieb Thomas von Aquin, ‚führt Menschen ganz natürlich zur Betrachtung der Himmelskörper.‘ Diesen Weg zu beschreiten, war das Wesen dessen, was es bedeutet ein Christ zu sein.“[4] Die extreme Konfliktthese, die einen unüberwindlichen Graben zwischen Glaube und Wissenschaft postuliert, übertreibt maßlos.[5] Sie übersieht Gläubige in der Spitzenforschung und verdreht die Ursprünge der Naturwissenschaften. Sie geht von unbewiesenen Voraussetzungen aus, die noch dazu unseren Zugang zur Wirklichkeit einschränken.
Die (weiteren) Probleme des Szientismus
Hawking vertritt eine Position, die man Szientismus nennen könnte. Damit ist gemeint, dass die Naturwissenschaft der einzig zuverlässige Zugang zur Wirklichkeit ist und es nichts gibt, das nicht von irgendeiner Wissenschaft nachgewiesen werden könnte. Daraus resultiert auch die starke Ablehnung von Religion, die ja eben von weiteren Zugängen zur Wirklichkeit (z.B. durch Offenbarung) und von Ereignissen, die nicht durch Naturgesetze festgelegt wurden, ausgeht. Die Konfliktthese und der Szientismus führen aber zu offenen Fragen: Woher kommen ethische Werte? Was ist die Bedeutung des Menschen? Woher können wir auf Rettung hoffen?
Woher kommen ethische Werte?
Hawkings Buch ist voller Ethik. Mühelos gelingt ihm der Schritt vom Sein zu Sollen, der in ethischen Appellen endet. Dass man diesen Übergang nicht spürt, liegt daran, dass er einfach postuliert wird. Allerdings sieht die Philosophie hier einen unüberwindlichen Graben. Wie kommen wir vom Sein zum Sollen? Das ist eine sehr große Frage, die Hawking nicht thematisiert. Theoretische Physik liefert jedenfalls keinen Beitrag dazu. Hawkings Wissenschaft bleibt nicht deskriptiv, sondern wird sofort zu ethischen Aufforderungen: „Ich möchte mich all denen anschließen, die unmittelbares Handeln bei entscheidenden Herausforderungen unserer globalen Gemeinschaft einfordern“ (S. 28–29).
Der einzige Anhaltspunkt, woher für Hawking objektive ethische Werte und Pflichten kommen, ist seine Erwähnung des Blicks „auf die Erde vom All aus“ (S. 28). Diese Perspektive nennt Hawking die „große Offenbarung des Weltraumzeitalters“ (S. 28), die ihn zur Einsicht „ein Planet, eine Menschheit“ (S. 28) gebracht habe. Eine solche Einsicht stellte sich bei vielen Gläubigen allerdings schon etliche Jahrhunderte früher durch die Lektüre der Bibel ein, denn die Bibel sieht objektive ethische Pflichten und Werte in Gottes gutem Wesen begründet.
Was ist die Bedeutung des Menschen?
Ein ähnlicher Graben wie jener zwischen Sein und Sollen tut sich zwischen den Elementarteilchen und dem Wert menschlichen Lebens sowie dem Stellenwert menschlichen Bewusstseins und Erkenntnisvermögens auf. Hawking geht von einem hohen Wert des Menschen und der Menschheit aus, aber er erläutert nicht, wie dieser Wert aus der Zusammenballung zufälliger Naturteilchen entsteht.
„Hawking erklärt nicht, wieso wir in diesem unerbittlich deterministischen und zufälligen Universum etwas würdigen oder wem wir dankbar sein sollen – er postuliert es einfach und übergeht den großen inneren Widerspruch seiner Position.“
Ohne geliebte Menschen wäre er nicht nur viel früher gestorben, ohne sie wäre alles bedeutungslos: „Doch es wäre ein wahrhaft leeres Universum ohne die Menschen, die ich liebe und die mich lieben. Ohne sie würden mir die Wunder des Kosmos nicht das Geringste bedeuten“ (S. 46). Hawking fährt gleich im nächsten Absatz fort: „Im Grunde sind wir Menschen selbst nur Ansammlungen fundamentaler Teilchen der Natur“ (S. 46). Menschen sind also voller Bedeutung – und bedeutungslos. Denken wir daran, „wie unbedeutend und zufällig menschliches Leben im Universum ist“ (S. 52). Er selbst erlebte diese Sinnlosigkeit nach seiner verheerenden Diagnose. Doch dann ging es ihm wieder besser: „Ich begann, mich über alles zu freuen, was ich hatte. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung“ (S. 35). Unser Leben ist kostbar: „Wir haben nur dieses Leben, um den großen Plan des Universums zu würdigen, und dafür bin ich außerordentlich dankbar“ (S. 63). Hawking erklärt nicht, wieso wir in diesem unerbittlich deterministischen und zufälligen Universum etwas würdigen oder wem wir dankbar sein sollen – er postuliert es einfach und übergeht den großen inneren Widerspruch seiner Position.
Woher können wir auf Rettung hoffen?
Die Menschheit braucht Rettung vor unzähligen Gefahren, die das biologische Leben bedrohen und die geistige Entwicklung Einzelner hemmen. Hawking setzt seine Hoffnung auf zukünftige „Menschen mit Einfluss und Macht“: „Mögen sie die Kraft haben, die Ziele der nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, und nicht aus Eigennutz handeln, sondern im Interesse des Gemeinwohls. Ich weiß nur zu gut, wie kostbar die Zeit ist. Nutzt den Augenblick! Handelt jetzt!“ (S. 29). Zugang und Begeisterung für Naturwissenschaft ist dabei unerlässlich:
„Wir müssen sicherstellen, dass diese Generation nicht nur die Möglichkeit, sondern auch den Wunsch hat, sich schon früh und gründlich auf das Studium der Naturwissenschaften einzulassen. So kann sie später ihr Potenzial entfalten und eine bessere Welt für die gesamte Menschheit hervorbringen.“ (S. 233)
Naturwissenschaft wird uns also retten – falls wir überhaupt zu retten sind. Sicher brauchen wir dafür Weisheit, um sie richtig einzusetzen oder ihr Zerstörungspotenzial rechtzeitig einzuhegen. Aber woher diese Weisheit kommen wird – außer von inspirierenden Lehrern – bleibt unklar. Für Gläubige ist es einleuchtend, hier auf den Lehrer Jesus Christus hinzuweisen, der weise ist und nachweislich Menschen dahingehend verändern kann[6], im Interesse des Gemeinwohls zu handeln. Die offenen Fragen des Szientismus waren Ethik, Menschenwürde und Erlösungshoffnung. Hawking spricht viel darüber. Seine Aussagen zu seinem persönlichen Leben, seine Begeisterung für die Menschen und seine Hoffnungen und Ängste tragen dazu bei, die Emotionen der Leser anzusprechen, um überzeugender zu wirken. Allerdings schwächt das aufgrund innerer Widersprüche die Überzeugungskraft seiner rationalen Argumente ab.
Wissenschaftlich hat Hawking doch recht, oder?
Hawking mutet den Lesern viele wissenschaftliche Details zu. Nach der Lektüre des Kapitels über schwarze Löcher und ihre möglichen Supertranslationen stellte ich mir die Frage: Wer wird diese Aussagen verstehen? Geht es dem Autor nicht eher darum, eine Geschichte zu erzählen? Diese Geschichte könnte lauten: Es gab eine Krise für die Wissenschaft. Aber es gibt diese neue Theorie. Die wird uns helfen. So stärkt der weltberühmte Kosmologe den Glauben an die Problemlösungskompetenz und zukünftigen Erfolge der Naturwissenschaft.
Wenn das Buch bewirkt, den Glauben an die Wissenschaft zu stärken und den christlichen Glauben an Gott zu unterminieren, was könnte Gläubigen helfen, um sich gegen die scheinbare Übermacht von Hawkings Thesen zu wehren?
Altbewährtes hilft bei Altbekanntem
Was seine Aussagen im Zusammenhang mit der Frage nach Gottes Existenz betrifft, hilft die Lektüre von John Lennox’ Buch, Stephen Hawking, das Universum und Gott. Da die „kurzen Antworten“ keine bahnbrechenden neuen Ergebnisse verarbeiten, können interessierte Leser immer noch viel über die wissenschaftlichen Aspekte aus dem Buch von Lennox erfahren.[7]
Genaue Lektüre ist förderlich
Es hilft aber auch, das vorliegende Buch sehr genau zu lesen. Hawking gibt oft zu, dass seine Aussagen nicht allgemein anerkannt sind, dass Theorien derzeit fehlen, dass Fragen immer noch offen sind.
Offene wissenschaftliche Fragen: Hawking rechnet damit, dass wir erst in den nächsten 50 Jahren herausfinden, was beim Big Bang geschah, wie das Leben entstand und vielleicht, ob es noch irgendwo sonst Leben gibt. Für den Ausgangszustand des Universums „scheint es Gesetze geben zu können“ (S. 54). Der Ursprung des Universums „[d]ürfte schon bald“ klar sein. „Noch haben wir kein vollständiges Bild, aber ich glaube mehr und mehr daran, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind“ (S. 66). Selbiges gilt bei der Einbindung der „Unschärferelation in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie“ (S. 78). Auch die Entstehung des Lebens geschah „irgendwie“ (S. 97), kaum „durch Zufallsfluktuationen“ (S. 98), kaum im All und ist im Labor nicht reproduzierbar:
„Im Labor können wir aus nicht lebendem Material keine dieser Nukleinsäuren herstellen. Doch wenn 500 Millionen Jahre zur Verfügung stehen und Ozeane den größten Teil der Erde bedecken, könnte durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die RNA durch einen Zufall hervorgebracht wurde.“ (S. 100)
Andere Meinungen: Ist die Zeit absolut? „Diese Vorstellung herrscht heute noch in den Köpfen vieler Wissenschaftler“ (S. 68). Hawking vertritt die Theorie, das Universum habe keine Grenze in Raum und Zeit. Dabei hilft „ein mathematischer Kunstgriff“ und die Verwendung der „imaginären Zeit“ (S. 80). Nicht alle Wissenschaftler folgen ihm dabei.
Untaugliche Erklärungen: Hawking spricht explizit über die unglaublichen Zufälle, die unser Universum lebensfreundlich machen. Er warnt aber davor, hier an Gott zu denken und wischt alle Gedanken an einen dahinterliegenden Gestalter mit dem „anthropischen Prinzip“ vom Tisch. Was versteht er darunter? Einerseits: „Das heißt, ich werde die Werte der physikalischen Konstanten als gegeben voraussetzen“ (S. 95). Wir fragen aber nach einer Erklärung der Phänomene und nicht, was passiert, wenn man sie einfach als gegeben voraussetzt. Andererseits besagt das anthropische Prinzip, dass wir uns notwendigerweise in einem Universum und auf einem Planeten befinden, die beide so gestaltet sind, dass unser Leben möglich ist. Die Frage, warum das so ist, lässt sich nicht mit einem Hinweis darauf beantworten, dass wir es ja nicht beobachten hätten können, wenn es anders gewesen wäre, und es daher so sein musste. Dieser Gedanke gleicht folgender Argumentation: Ich beobachte einen Schmetterling. Warum flog der Schmetterling vorbei? Er musste, denn sonst hätte ich ihn ja nicht beobachten können. Das beantwortet die Frage natürlich nicht, auch wenn ich es „Anthropisches Schmetterlingsprinzip“ nennen würde.
Fragwürdige Analogie: Hawking erklärt, das Universum sei einst so klein gewesen wie ein Proton. Dann sagt er, dass es ebenso wie ein Proton aus einer Quantenfluktuation entstanden sei. Er sagt also, dass ein Universum und ein Proton gleich entstehen können, weil sie gleich klein anfangen. Mir als Laien hätte es geholfen, wenn er erklärt hätte, weshalb das gilt. Selbst im Moment der Entstehung war das Universum doch äußerst anders beschaffen als ein Proton. Und wenn so etwas regelmäßig stattfindet, warum beobachten wir nicht laufend die Entstehung von Universen?
Fazit
Zu lesen, womit Hawking sich beschäftigte, ist faszinierend. Seine großen Fragen sprechen reale Probleme an: die Ressourcenerschöpfung auf der Erde, Klimawandel, Gefahren durch künstliche Intelligenz oder Asteroiden. Nüchtern rechnet er auch damit, dass Menschen in der Wissenschaft alles mit dem menschlichen Erbgut anstellen werden, was sie können – selbst wenn es dafür Verbote geben sollte. Er sieht die Menschheit sich in Richtung transhumaner Maschinenwesen entwickeln. All das ist spannend zu lesen. Auch seine persönlichen Bemerkungen sind oft mitreißend und lustig – wie etwa die Durchführung seiner Party für Zeitreisende (leider kam niemand). Seine Einstellung zu seiner Krankheit ist bewegend, seine ethischen Werte und wissenschaftlichen Leistungen sind bewundernswert. All das macht das Buch zu einer guten Lektüre.
Dabei hilft es, Hawkings weltanschauliche Grundannahmen bewusst wahrzunehmen. Die Wissenschaft ist für ihn der Weg zur Wahrheit und der Grund zur Hoffnung. Determinismus ist das grundlegende Prinzip – und dieses Prinzip ist fragwürdig. Die Lücken in der wissenschaftlichen Erkenntnis treten klar hervor. Auch die Widersprüche zu seinen sehr hohen Ansichten von Ethik und Menschenwürde werden dann deutlich. Die wissenschaftlichen Aussagen in seinen kurzen Antworten sind nicht neu, daher ist bereits darauf geantwortet worden.
Buch
Stephen Hawking, Kurze Antworten auf große Fragen, Stuttgart: Klett-Cotta, 7. Auflage 2021, 253 Seiten, 11 EUR.
[1] Vgl. „Gläubige in der Naturwissenschaft“, online unter: https://www.begruendetglauben.at/glaeubige-in-der-naturwissenschaft/ (Stand: 01.02.2023).
[2] Vgl. „Christentum und die Entstehung der modernen Naturwissenschaft“, online unter: https://www.begruendetglauben.at/christentum-und-die-entstehung-der-modernen-naturwissenschaft/ (Stand: 01.02.2023).
[3] Ähnlich hinderlich für Erkenntnis ist das Prinzip, das hinter Hawkings Diskussion von „Ufo-Sichtungen“ zu stehen scheint. Er sagt: „Die Berichte über Ufo-Sichtungen können nicht alle auf echten Begegnungen mit Außerirdischen beruhen, da sie sich gegenseitig widersprechen. Doch wenn Sie zugeben, dass einige falsch oder halluziniert sind, ist da nicht die Annahme wahrscheinlicher, dass sie es alle sind, als zu glauben, dass wir tatsächlich von Leuten aus der Zukunft oder von der anderen Seite der Milchstraße besucht worden sind?“ (S. 163). Hawking verrät uns nicht, wieso dies wahrscheinlicher ist. Wenn einzigartige Ereignisse als unwahrscheinlich abgelehnt werden, weil es auch viele unwahre Berichte darüber gibt, können blinde Flecken entstehen.
[4] „‚Holy Scripture,‘ Aquinas had written, ‚naturally leads men to contemplate the celestial bodies.‘ To take that path was the very essence of being a Christian.“ (Tom Holland, Dominion: The Making of the Western Mind, London: Little Brown, 2019, S. 335).
[5] Zu verschiedenen Modellen der Beziehung zwischen Glaube und Naturwissenschaft vgl. „Sind Glaube und Wissenschaft vereinbar?“, online unter: https://www.begruendetglauben.at/sind-glaube-und-wissenschaft-vereinbar/ (Stand: 01.02.2023).
[6] Vgl. „Kategorie: Der Weg der Revolution“, online unter: https://www.begruendetglauben.at/category/gut/warum-ist-das-evangelium-gut-positive-auswirkungen/der-weg-der-revolution/ (Stand: 01.02.2023).
[7] Zum Einstieg vgl. z.B. Stephen Hawking und Gott, online unter: https://www.begruendet-glauben.org/naturwissenschaften/lennox-stephen-hawking-und-gott/ (Stand: 01.02.2023).