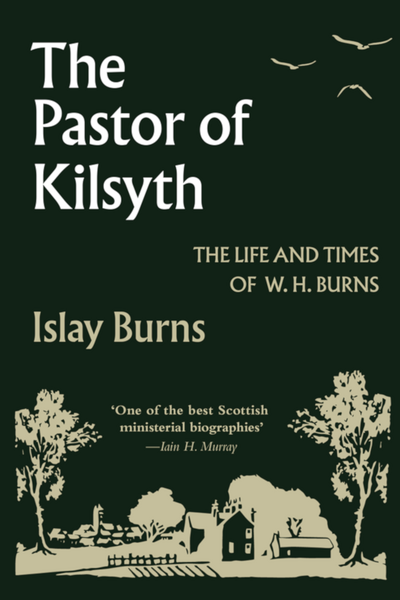
The Pastor of Kilsyth
Vom kostbaren Dienst eines Gemeindehirten
Ein Privileg, aber auch eine unheimliche Last – so würden viele die pastorale Arbeit umschreiben. Die Gründe dafür sind nachvollziehbar: Da sind einerseits die begrenzten Kräfte und Begabungen von Leitern und Mitarbeitern. Andererseits sind da die persönlichen Nöte, Fragen und Hoffnungen der Menschen; nicht zu vergessen die vielen Chancen und Sackgassen, die sich den Gemeindehirten mal abwechselnd, mal gleichzeitig in den Weg stellen. Für viele ist der Druck zuletzt noch gewachsen. Da ist der kulturelle Gegenwind in weltanschaulichen und ethischen Fragen. Da ist die Corona-Pandemie als globale und lokale Heraus- und Überforderung. Da sind näher rückende kriegerische Konflikte, die viele Sicherheiten und Versprechen des säkularen Westens hinterfragen. Da sind ambivalente Trends in Gemeindebünden, und allzu greifbare Geschichten von christlichen Leitern, die disqualifiziert oder ausgelaugt aus dem Dienst ausscheiden. Zugleich aber – und das ist paradox vielsagend – stehen wir vor einem ungeheuren Pastorenmangel.
Tiefe Fragen statt schnelle Lösungen
Statt niedergeschlagen zu resignieren oder kurzsichtig neue Strategien zu entwerfen, ließe sich fragen: Wie können wir in den aktuellen Umständen christliche Mitarbeiter kurzfristig unterstützen, mittelfristig zurüsten und Gemeinden langfristig stärken? Natürlich könnten wir noch grundsätzlicher nachhaken: Was macht eigentlich einen Gemeindehirten aus? Und wie gestaltet sich sein Dienst an den Menschen, die ihm anvertraut wurden?
Hier kann ein Blick in die Vergangenheit helfen. Ursprünglich im Jahr 1860 veröffentlicht, erzählt der Autor des Büchleins The Pastor of Kilsyth die Geschichte seines eigenen Vaters. William Hamilton Burns (1779–1859) war im besten Sinne ein normaler Pastor im ländlichen Raum. Der Verleger bemerkt zur vorliegenden Neuauflage:
„Er [W. H. Burns] füllte keine prestigeträchtige Kanzel, er übernahm keinen wichtigen Lehrstuhl in Theologie. Er gründete keine Organisation. Er diente einfach in relativer Unbekanntheit, das aber tat er treu und beharrlich.“ (S. viii)
Kindheit und Jugend, Ausbildung und Dienst in Zeiten des Umbruchs
Aufgewachsen in einer kinderreichen christlichen Familie und verwurzelt in der schottischen Kultur, hegte Burns schon in Grundschulzeiten ein reges, ehrliches Interesse an geistlichen Fragen. Interessant ist, dass der Autor in diesem Anfangskapitel nicht sehr ausführlich über die frühen Jahre seines Vaters berichtet. Stattdessen beschreibt er die Frömmigkeit der damaligen Zeit, die gesellschaftliche Situation, ebenso die angespannte Lage und den geistlichen Tiefpunkt der Church of Scotland.
Ungewöhnlich aus heutiger Sicht, aber durchaus normal zu damaligen Zeiten, verbrachte W. H. Burns nur wenige Jahre in der Schule, um dann mit einer Grundbildung als Teenager direkt an die Uni nach Edinburgh zu wechseln. Akademische Studien und theologische Ausbildung, eindrückliche und manchmal exzentrische Lehrer, ein reges Gemeindeleben und die Begegnung mit theologisch Andersdenkenden – alle diese Dinge prägten das Denken und den Glauben des jungen Studenten.
Mit 21 Jahren trat Burns seine erste Pastorenstelle an der Ostküste Schottlands an. In jener Zeit lernte er seine Frau kennen, mit der er schließlich 54 Jahre verheiratet war und eine Familie gründete; auch fand er neue Freunde und Gefährten in benachbarten Gemeinden. Deutlich wird beim Lesen der Auszüge aus Burns’ Tagebuch, wie der Dienst in einer Landgemeinde einem ganz eigenen Rhythmus folgte, dabei aber nie langweilig war. Sein Sohn fasst hier zusammen:
„Er predigte das Wort; teilte das heilige Abendmahl aus; ermahnte die Nachlässigen; tröstete die Traurigen; taufte Kinder; segnete die Ehe junger und liebender Herzen; besuchte die Kranken, die Sterbenden; begrub die Toten; hielt die Hand und sprach Worte des Friedens in die Ohren von Trauernden; ließ der armen Witwe und dem verlassenen Waisen die Wohltat der Gemeinde und auch seine eigene zukommen … stets bei seiner Arbeit und immer zufrieden darin, ohne etwas Besseres oder Höheres auf Erden zu begehren. Er war glücklich dort.“ (S. 44)
Burns baute vertrauensvolle Beziehungen zu den Menschen auf und war für sie da, auch hielt er im Alltag eine Lernroutine und das eigenständige theologische Studium aufrecht. Sein Herzensanliegen war, mit Gottes Gnade schlicht und normal in jenen Verantwortungsbereichen zu dienen, in die Gott ihn hineingestellt hatte. Das erwies sich als eine gute Vorbereitung für die nachfolgende Etappe.
Neue Herausforderungen und ein neues Zuhause
Im Jahr 1821 wurde Burns in einen anderen Bezirk berufen, der sich von seinem bisherigen Einsatzgebiet markant unterschied. Das Einzugsgebiet von Kilsyth in der Nähe der Großstadt Glasgow war größer und stärker besiedelt, das Leben dort war um vieles komplexer als das, was er bis dahin gewohnt war. Die geistliche Situation der Gemeinde und der Gesamtbevölkerung fand er gleichermaßen „entmutigend und hoffnungsvoll“ (S. 75).
Nun erwiesen sich die 20 Jahre Diensterfahrung, sein mittlerweile gefestigter Charakter, Burns’ stetiges Studium von Bibel und Theologie, ebenso seine Offenheit für neue Freundschaften mit anderen Pastoren als ein echtes Pfund. Jenseits der öffentlichen Gottesdienste konzentrierte sich der neue Gemeindehirte auf den regelmäßigen Besuchsdienst, um die Menschen in ihrer Situation kennenzulernen und sie nachhaltig bzw. geistlich zu prägen.
Interessant ist daneben der Einblick in das Familienleben des Pastors von Kilsyth. Auch wenn der Autor zugibt, dass er gerne noch mehr Zeit mit seinem Vater verbracht hätte, beschreibt er nachvollziehbar dessen Präsenz sowie das ruhige Temperament, das schließlich von der aktiven Mutter Elizabeth ausgeglichen wurde.
Die Hoffnung auf einen geistlichen Aufbruch
Eine interessante Eigenart der britischen Kirchengeschichte ist die Tatsache, dass außerhalb Englands immer wieder geistliche Aufbrüche stattgefunden haben (vgl. Arthur Fawcett, The Cambuslang Revival; John Weir, The Ulster Awakening; Thomas Phillips, The Welsh Revival). Weit davon entfernt, Erweckungen produzieren zu wollen (vgl. Iain Murray, Revival And Revivalism), hatten Burns und seine Kollegen ebenfalls eine theologische Kategorie sowie eine grundsätzliche Offenheit für Gottes Wirken in ihren Kirchengemeinden.
Diese Offenheit entwickelte sich in den Jahren von 1830 bis 1838 zu einer konkreten Sehnsucht und zu einem Gebet, das Gott anscheinend langsam erhörte. Immer häufiger kamen in dem Gebiet Menschen zum Glauben und erlebten tiefgreifende Veränderung in ihrem Leben. Zusätzlich beobachtete man bei langjährigen Christen einen neuen Ernst und eine fröhliche Hingabe an Christus.
Wie sich die Erweckung dann innerhalb weniger Monate während des Jahres 1839 auswirkte, skizziert der Autor des Büchleins anhand von zeitgenössischen Briefen und Augenzeugenberichten. Anders, als man heute meinen würde, gab es hier keinen einzelnen, charismatischen Redner. Vielmehr arbeiteten die Pastoren zusammen und ergänzten sich in der Verkündigung; sie organisierten Gebetstreffen, waren intensiv in der Seelsorge eingespannt und bemühten sich, den Menschen zu dienen und auf strukturierte Weise geistliches Wachstum und Jüngerschaft zu fördern. So gewinnt man beim Lesen der Zeugnisse den Eindruck: Diese Erweckung war einerseits außergewöhnlich, andererseits aber unglaublich bodenständig.
Süße Früchte und belastende Entwicklungen
Überraschenderweise geht der Autor auch auf Stimmen ein, die den Ereignissen des Jahres 1839 kritisch oder zynisch gegenüberstanden. Die Stadt Kilsyth wurde nicht zu einem himmlischen Jerusalem, und manche Menschen fielen wieder in alte Lebensmuster zurück. Dennoch zeigt sich in den Beobachtungen und theologischen Reflexionen von Burns’ Sohn, dass hier nachweislich ein „reales und überaus gesegnetes Werk des Heiligen Geistes“ (S. 145) stattgefunden hatte.
Eine echte Belastung für viele Gläubige war schließlich die Spaltung der Church of Scotland im Jahr 1843. W. H. Burns trat aufgrund seiner theologischen Überzeugungen den Weg in die evangelikale Free Church of Scotland an. Das Kirchengebäude sowie ihr Zuhause aufzugeben, für das Burns und seine Familie nun kein Nutzungsrecht mehr besaßen, erwies sich als kein leichter Schritt. Dennoch folgten ihm hunderte von Gläubigen und die Gottesdienste wurden in den Sommermonaten im Freien abgehalten, bis ein neues Kirchengebäude inkl. Pfarrhaus zur Verfügung stand.
Ein stilles Ende und ein geistliches Erbe
Nach seinem 50-jährigen Dienstjubiläum machten sich bei Burns stärker Alterserscheinungen bemerkbar und es wurde ein Kollege bzw. Nachfolger gefunden. Dennoch engagierte er sich weiter in der Gemeindearbeit, so gut es eben ging. Im Jahr 1858 wurde Burns schließlich ernsthaft krank, was er überrascht und doch mit Gelassenheit aufnahm.
Seine letzten Stunden im darauffolgenden Jahr waren von einer besonderen Schwäche und kurzen Anfechtungen gekennzeichnet; im Kreis der Familie klammerte er sich noch einmal mit ganzem Herzen an die Wahrheiten des Evangeliums. Die Welt würde sich unbeeindruckt weiterdrehen, doch Burns vertraute sich dem an, der ihn aus lauter Gnade am Kreuz erkauft hatte – und schlief dann friedlich ein. Auszüge aus der Beerdigungspredigt zeigen noch einmal, wie dieser einfache, stetige, begabte, unperfekte Pastor und Familienmann für viele Menschen ein Hirte und geistlicher Vater sein durfte.
Im Anhang des Buches finden sich schließlich noch vier Predigtmanuskripte, die einen Einblick in Burns’ theologisches Denken und in sein Hirtenherz geben. Ebenso ist ein ausführlicher Themenvortrag abgedruckt, den der Pastor von Kilsyth bei einer Pastorenkonferenz gehalten hatte und in dem sich so manche praktisch-theologische Perle finden lässt. Dieser hat den Titel: „Über die Art und Weise, einer Erweckung vorzustehen, um einen derartigen Besuch der Gnade zu begünstigen, mit der Beschreibung jener Fehler und Übel, vor denen es sich zu hüten gilt“ (S. 187–230).
Zurückblicken, um voranzugehen
Auf den ersten Blick werden vor allem jene ihre Freude an dem Buch haben, die kirchengeschichtlich interessiert sind oder ein Faible für Schottland haben. Die teils ausladende Sprache ist für moderne Leser zunächst gewöhnungsbedürftig, auch der innere Aufbau der zwölf Kapitel ist nicht komplett linear. Regelmäßig setzt der Autor Kenntnisse der presbyterianischen schottischen Kirche und ihrer Gepflogenheiten voraus. Zeitweise gerät er auf Nebengleise, erklärt scheinbar ‚unwichtige‘ Zusammenhänge, verliert sich in Charakterisierungen von Personen oder greift theologische Grundsatzfragen auf. Somit präsentiert das Buch nach heutigen Maßstäben keine typische Biografie.
„Die Schönheit, der Wert und die Kraft des Evangeliums zeigen sich nicht zuletzt in einem treuen Dienst als Hirte der Gemeinde Jesu.“
Stattdessen vermittelt The Pastor of Kilsyth seinen Lesern jedoch eine Haltung und weckt eine Sehnsucht: Die persönliche Liebe zum dreieinigen Gott, die gemeinsame Freude an seinem inspirierten Wort, und der beharrliche Einsatz für die Menschen sind der starke Gnadenmotor, der ein menschliches Leben über Jahrzehnte befeuern, erfüllen und für die Ewigkeit auszeichnen kann.
Ja – wir leben heute in besonderen Zeiten. Und nein – früher war nicht alles besser (vgl. Pred 7,10). Dennoch kann der Blick in die Vergangenheit helfen, eine bestimmte Vision von Gemeinde und dem pastoralen Dienst zurückzuerlangen. Jenseits von Programmgläubigkeit, Pragmatismus und Personenkult, jenseits von kalter Orthodoxie und labilem Liberalismus erinnert uns dieses Buch aus dem Jahr 1860 an eine einfache und doch zentrale Wahrheit: Die Schönheit, der Wert und die Kraft des Evangeliums zeigen sich nicht zuletzt in einem treuen Dienst als Hirte der Gemeinde Jesu.
Buch
Islay Burns, The Pastor of Kilsyth: The Life and Times of W. H. Burns, Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2019. xvi + 296 Seiten. Ca. 15 Euro, auch als E-Book erhältlich.