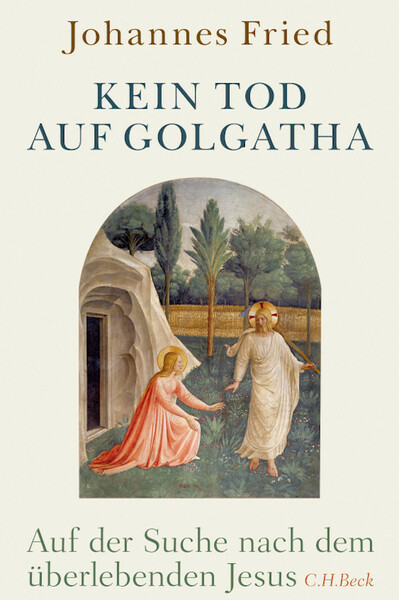
Kein Tod auf Golgatha?
Seitdem die christliche Botschaft von der Auferstehung ihres Erlösers an die Öffentlichkeit kam, gab es immer wieder Versuche, das Phänomen des leeren Grabes auf natürliche Weise zu erklären. Dies ist kein Zufall, da das Christentum keine nur auf religiöse Gefühle oder soziale Interessen, auch nicht auf bloße individuelle Erfahrung angelegte Glaubensidee oder religiöse Weltanschauung ist. Gerade in Bezug auf die Auferstehungsfrage beansprucht es historische Plausibilität, die die Glaubenserfahrung erst ermöglicht.
Nun hat der renommierte Historiker Johannes Fried eine altbekannte, überholt geglaubte Erklärung für das leere Grab quasi „wiederbelebt“. In seinem Buch Kein Tod auf Golgatha, das 2019 bereits in zweiter Auflage erschien, erlaubt er sich einen Ausflug in die neutestamentliche Forschung, die Theologie- und Kirchengeschichte, aber auch in das Terrain der Medizin.
Eine hypothesenreiche Abhandlung in zwei Teilen
Einleitend schreibt Fried im Vorwort, dass er zunächst einer Empfehlung folgen wollte, „die Geschichte zu einem Kriminalroman auszuspinnen“, dies aber dann doch unterließ, da es zu blasphemisch wirken könnte. „So wurde der Text zu dem, was er jetzt ist: eine hypothesenreiche historische Abhandlung“, die ihm „endlosen Widerspruch und Feindschaften einbringen“ würde (S. 7). Im Epilog gesteht er, dass die „Geschichte, die hier verfolgt wurde“, das „unglaublichste, widersinnigste Geschehen“ ist, „an dessen Erforschung ich mich je gewagt habe.“ (S. 165)
Er teilt seine Ausführungen in zwei Teile. Im ersten legt er seine These dar („Kein Tod auf Golgatha“). Im zweiten macht er sich auf die Suche nach der möglichen Fortsetzungsgeschichte (Untertitel: „Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus“). In sechs Kapiteln und einem zusammenfassenden Schluss wird dieses Abenteuer einer Neuinterpretation der Christentumsgeschichte durchgeführt.
Eine Entlastungspunktion auf Glatteis
Mit dem ersten Kapitel thematisiert der Autor sein Projekt einer Neuauflage der Scheintodhypothese, wobei ihm bewusst ist, dass er sich dabei auf „Glatteis“ begibt (S. 21). Im zweiten Kapitel offenbart er den Anlass zu seiner Idee, nämlich die medizinisch begründbare Möglichkeit einer Lebensrettung aufgrund des Lanzenstichs, durch den ein kleiner Sauerstoffvorrat in der „Pleurahöhle“ das Überleben des Gekreuzigten gesichert hätte. Beweis: der Bericht über das Austreten eines Sekrets aus Wasser und Blut, genau wie es im Johannesevangelium wiedergegeben wurde (Joh 19,34). Es handle sich dabei um eine Art „Entlastungspunktion“ zur Linderung der Atemnot (S. 37). Moderne medizinische Kenntnisse und das „Indizienensemble, wie es Johannes vollständig ausbreitet“ (S. 49), lassen für Fried kaum Zweifel darüber aufkommen, dass dies die wahrscheinlichste Erklärung für das Überleben der Kreuzesfolter von Jesus darstelle. Im dritten Kapitel („Auferstehung“) erklärt er dann das Ostergeschehen vor diesem Hintergrund: Jesus selbst habe also überlebt und auch weitergewirkt, die Legendenbildung um seine Auferstehung, von der Fried ausgeht, aber hätte eine Eigendynamik bekommen.
Die Spurensuche beginnt
Mit dem vierten Kapitel unternimmt Fried dann die angekündigte Spurensuche ab der Kreuzesabnahme und gibt für diesen Abschnitt zu, dass seine „Überlegung … durch und durch hypothetisch [ist], nicht anders als jede andere Rekonstruktion des Lebens Jesu“ (S. 74). Die im Judentum plausible Himmelfahrtserklärung sei dann das ideale Mittel gewesen, um das Verschwinden des inzwischen untergetauchten Wiederbelebten zu erklären. Denn Jesus sei ja nach wie vor gefährdet gewesen. Er habe der römischen Justiz in die Hände fallen können. Zusammengefasst: Es gibt laut Fried zwei konkurrierende Geschichten, die aus spärlich (?) vorhandenen Quellen rekonstruiert werden müssten: der reale, wiederbelebte Jesus und die Auferstehungserzählung der frühen Gemeinde.
Hinweise in Fragmenten und Moscheen
Mit dem fünften Kapitel werden dann umfassend anhand nichtkanonischer Überlieferungsfragmente und einiger Evangelienberichte verschiedene mögliche Rückzugsorte Jesu (z.B. Ägypten) gemutmaßt, die dann auch einige der Wundererzählungen der Evangelien und anderes Material erklären würden. Quasi: Jesus als Wanderprophet und Wundertäter nach seiner Wiederbelebung. Im sechsten Kapitel führt Fried dann auch noch einige Suren des Koran und eine Inschrift in der Jerusalemer Omar-Moschee als potentielle Hinweise auf spätere Überlieferungen und Nachwirkungen dieses Geschehens an. Somit würde auch die islamische Tradition noch Hinweise auf die vermutete Parallelüberlieferung der Wirksamkeit Jesu liefern, die aber abseits der Hauptströmungen der kirchlichen Traditionslinie lägen.
Der Kriminalist unter den Historikern
In seiner Vorgehensweise sieht sich Fried tatsächlich als Kriminalist unter den Historikern, indem er eine Verkettung von Indizien erkennt, die der Historiker „kritisch betrachten und miteinander verbinden“ muss (S. 26). „Mehr als Konstrukte liefern sie in keinem Fall“ (S. 27). Insgesamt hinterlässt der Autor den Eindruck, als gebe es gar keine andere Möglichkeit, als frei fantasierend zu rekonstruieren, was denn nun am Kreuz und im Zuge der nachösterlichen Erzählung geschehen sei, da ja lediglich das Johannesevangelium ausgerechnet beim Kreuzigungsbericht absolut überzeugend und widerspruchsfrei geblieben sei.
„Insgesamt hinterlässt der Autor den Eindruck, als gebe es gar keine andere Möglichkeit, als frei fantasierend zu rekonstruieren, was denn nun am Kreuz und im Zuge der nachösterlichen Erzählung geschehen sei.“
Alles, was die neutestamentliche Forschung kontrovers diskutiert hat, wird von ihm selektiv seiner Grundthese untergeordnet. Historische Details des lukanischen Doppelwerks (Lukasevangelium und Apostelgeschichte) oder die früh von Paulus vermerkte Augenzeugenschaft bei Auferstehungserscheinungen (1Kor 15) werden von Fried als nachösterliche Konstruktionen ohne historische Plausibilität gewertet. Was Fried dann schlussfolgert, hängt somit an den beiden „Beweisen“, die er liefert: dem Johannesbericht und dem medizinisch erklärbaren Ausnahmezustand eines Überlebenden nach seiner Abnahme vom Kreuz.
Nur Johannes sei zuverlässig – aber nur teilweise
Das Johannesevangelium als alleiniger „Bericht eines Augenzeugen überliefert einzigartige, dem ersten Anschein nach realistische, auch zuverlässige und ausführliche Details über Jesu Todestag (Karfreitag), über sein Sterben und seinen Tod am Kreuz. Nichts mehr von jenem Lichtwesen und göttlichen Logos des Evangelienbeginns.“ (S. 29) Alles andere – die drei synoptischen Evangelien und viele übrige Teile des Johannesevangeliums – gebe nur spätere Überlieferungen der nachösterlichen Gemeinde wieder, keine authentischen Berichte.
Für Fried folge hingegen Johannes’ „Bericht ... keinen fremden Mustern, sondern der eigenen Wahrnehmung“ (S. 30). Ein Hinweis für die historische Zuverlässigkeit genau dieser Stelle sei ausgerechnet eine Erkenntnis über Unfallopfer aus der chirurgischen Medizin: Jesus wäre in seinem Trauma einer „CO2-Narkose“ erlegen, wobei der Lanzenstich des römischen Soldaten sein Überleben gesichert habe.
Ein Gemisch aus Fakten und Fiktion
Spätestens ab dem Kapitel über die Auferstehungsbotschaft (S. 51–75) scheint Fried den Boden gesicherter Erkenntnisse unter den Füßen zu verlieren. Er reimt darin unterschiedlichste Motive so zusammen, dass sie ein vermeintlich schlüssiges Bild zu seiner These bilden: das hypothetische Evangelium, das der Häretiker Marcion (Mitte des zweiten Jahrhunderts) angeblich besessen haben soll (eine auf Klinghardt, Das älteste Evangelium, 2015, zurückgehende These), die Rolle der Ratsherren Nikodemus und Joseph von Arimathia, etc. Dabei verschleiert er, wie Fiktion und Fakten hier getrennt werden könnten. Die Indizienlage lade ein, eine völlig neue, spannende Geschichte zu entwerfen, die noch viel Raum für weitere Erkenntnisse liefere.
„Hat sich die nachösterliche Gemeinde einer Wunschidee angeschlossen oder gilt dies vielleicht eher für einen postmodernen Dekonstruktivismus?“
Der 2006 mit einem Preis für wissenschaftliche Prosa ausgestattete emeritierte Professor Fried wirft vage das eine oder andere Argument der kritischen neutestamentlichen Forschung in den Raum (z.B. die sogenannte „Differenztheorie“, die versucht, echte Jesusworte von jüdischer und christlicher Überlieferung herauszufiltern). Es ist nicht möglich, sich ein Bild davon zu machen, was nun damals überliefert und was reine Geschichtskonstruktion und Fantasie ist. Hat sich die nachösterliche Gemeinde einer Wunschidee angeschlossen oder gilt dies vielleicht eher für einen postmodernen Dekonstruktivismus? Man hat fast den Eindruck, Erzählungen, wie die von Fried, sähen zwar einen Splitter im Auge der jungen Christengemeinde, die an die Auferstehung geglaubt hat, erkennen aber nicht den Balken in der eigenen Ausgestaltung (post)moderner Geschichtskonstruktionen.
Ein alter Hut, der aber nicht passt
Die Idee, man könnte das Ostergeschehen mit der Wiederbelebung (sog. „Ohnmachtstheorie“) eines nur scheinbar zu Tode gekommenen Gekreuzigten erklären, wurde schon vom Theologen der alten liberalen Schule, David Friedrich Strauss (1808–1874), der selbst nicht an eine Auferstehung glaubte, zurückgewiesen:
„Es ist unmöglich, dass einer, der gerade halbtot aus dem Grab hervorgegangen ist, der schwach und krank herumkriecht und ärztliche Behandlung, Stärkung und zärtliche Fürsorge braucht, bei den Jüngern je den Eindruck hätte erwecken können, dass er Sieger über den Tod und das Grab - und sogar der Fürst des Lebens ist. Dieser Glaube lag ihrem späteren Dienst zugrunde. Eine solche ‚Wiederbelebung‘ hätte nur den Eindruck schwächen können, den er in seinem Leben und Sterben auf sie gemacht hatte. Sie hätte aber unmöglich ihr Leid in Begeisterung oder ihre Ehrfurcht in Anbetung verwandeln können.“[1]
Fried geht den klassischen Einwänden zwar mit seinem neueren Erklärungsversuch aus dem Weg. Dieser kann aber kaum überzeugen, da selbst eine theoretische Möglichkeit einer (begrifflich anfechtbaren) sog. CO2-Narkose, die sein Überleben gesichert habe, keine Erklärung für all das ist, was durchaus bezeugt wurde. Wenn man natürlich vieles, was mit den Auferstehungsberichten zu tun hat, reflexhaft einer späteren Erzählung zuordnet, wird eine neue Erklärung für das leere Grab notwendig. Letzteres zumindest scheint dem Historiker Fried auch mit der neutestamentlichen Überlieferung ein gesichertes Faktum zu sein.
Fazit
Frieds Versuch, die Christentumsgeschichte aufgrund einer angeblich neueren Faktenlage neu zu deuten, kann nur als spekulativ, aber nicht als historisch plausible These angeboten werden. Eine Untersuchung über eine mögliche nachösterliche Fortsetzungsgeschichte eines irdischen Wanderpredigers parallel zu einer von der christlichen Kirche verbreiteten Auferstehungserzählung eignet sich für einen Fantasieroman, aber nicht für eine historische Spurensuche.
„Frieds Versuch, die Christentumsgeschichte aufgrund einer angeblich neueren Faktenlage neu zu deuten, kann nur als spekulativ, aber nicht als historisch plausible These angeboten werden.“
Es ist schade, dass ein renommierter Historiker zu den unzähligen Versuchen, das Christentum ohne übernatürliche Offenbarung zu erklären, noch ein letztlich rein auf Vermutungen aufgebautes Werk hinzufügt. Andererseits bestätigt er damit, dass es sich durchaus lohnt, sich mit der Frage der Auferstehung und der Glaubwürdigkeit direkt und gründlich zu beschäftigen, was von anderer Seite auch schon unternommen wurde.[2]
Mit einer in diesem Zusammenhang rätselhaft wirkenden Anmerkung lässt Fried dann doch noch Spielraum für einen „Glauben“: „Der Glaube mag sich wandeln, mag ganz irdisch werden, trotzdem kommt keine aufklärerische, säkularisierte Ethik gegen ihn an. Das gilt auch für Jesu Lehren: Sein lebendiges Wort bleibt in Ewigkeit (vgl. 1Petr 2,23) und tröstet empfängliche Seelen“ (S. 167). Nachdem der Leser sich die Augen reibt, wie abenteuerlich hier mit vielen gewagten Konstruktionen der christliche Glaube als bloßes Fantasieprodukt präsentiert wird, kann eine solche Aussage nicht mehr überzeugen.
Buch
Johannes Fried, Kein Tod auf Golgatha: Auf der Suche nach dem überlebenden Jesus, 2. durchgesehene Auflage, München: C.H. Beck, 2019, 189 Seiten.
[1] David Friedrich Strauß, zit. bei Paul Little, Ich weiß, warum ich glaube, 2. Auflage, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler-Verlag, 1985, S. 50.
[2] Siehe z.B. Gary Habermas’ Ressourcen: https://garyhabermas.com/ (Stand 21.3.2022).