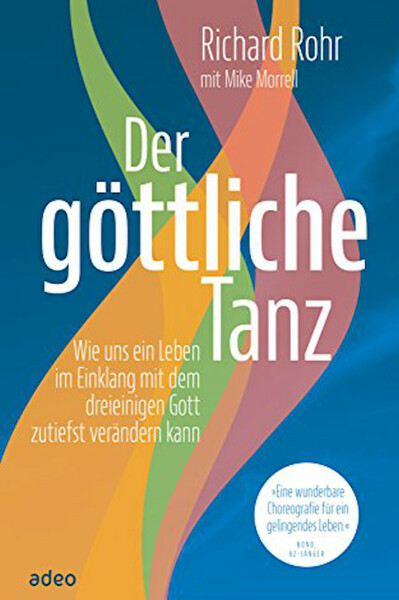
Der göttliche Tanz
Pater Richard Rohr glaubt an den Fluss. Da ist ein Strom, ein Fluss, fließend und strömend, manchmal ausdrücklich „göttlich“, ein „Strom, der durch alles hindurchfließt, ohne Ausnahme und von Anfang an“ (S. 28)[1]. In der amerikanischen Originalausgabe von Rohrs Buch Der göttliche Tanz: Wie uns ein Leben im Einklang mit dem dreieinigen Gott zutiefst verändern kann dokumentieren die über 150 Vorkommen des Wortes „flow“: Es ist dieser Fluss, den Rohr fortwährend propagiert, preist und predigt.
Der Fluss ist ein sich selbst verschenkender Austausch von Liebe und Leben. Wenn man Rohr fragen würde, ob dieser Fluss in erster Linie etwas mit Gott, mit der Welt oder mit dem Menschen zu tun hat, dann würde er zweifellos mit einem leidenschaftlichen „Ja!“ antworten, und seine funkelnden Franziskaner-Augen würden dabei franziskanisch funkeln. Der Strom überströmt den Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Er strömt von Gott aus, während Gott sich selbst entleert; er fließt zwischen Kreaturen und verbindet sie miteinander und mit dem Absoluten; er fließt zurück zu Gott, bereichert und beglückt dabei diese heilige Quelle, die sich daran erfreut, wenn endliche Geister zu ihrem wahren, göttlichen Selbst erwachen. „Der Fluss“ klingt wie ein Substantiv, ist aber in Wirklichkeit ein Verb. Der Fluss macht alle Substantive zu Verben, wenn sie mit ihm fließen. Tatsächlich ist bereits jedermann vom Fluss ergriffen, er müsste es einfach nur noch erkennen; die Widmung des Buches lautet: „Für alle Ahnungslosen, die nicht wissen, dass sie schon mitten im Fluss sind“ (S. 5). Dieser Strom ist göttlich und kosmisch und menschlich – alles auf einmal und stets vereint. Für Rohr ist das der springende Punkt.
Was bitte hat das alles mit der Dreieinigkeit zu tun?, magst du jetzt fragen. Gute Frage!
Rohr ist ein Bestsellerautor, der in der spirituellen Szene sehr populär ist. Er wird von der amerikanischen Star-Moderatorin Oprah empfohlen, im Klappentext von Bono gewürdigt und leitet ein Einkehrhaus in Albuquerque (New Mexico, USA). Rohr hat viele weitere Bücher geschrieben (auf einige verweist er hilfsbereit in den Fußnoten) und ich muss gestehen, dass ich lediglich dieses eine gelesen habe. Ich habe zu Der göttliche Tanz gegriffen, weil es darin nach eigenen Angaben um die Dreieinigkeit geht und auch, weil es einflussreich zu werden scheint. Die amerikanische Originalausgabe erschien mit Empfehlungen von Shane Claiborne, Jim Wallis, Nadia Bolz-Weber und Rob Bell. The Divine Dance war schon Wochen vor der Veröffentlichung die bestverkaufte Neuerscheinung zum Thema Dreieinigkeit – genauer: der Bestseller überhaupt unter den neuerschienenen theologischen Büchern bei Amazon.
Mit anderen Worten, Pater Richard Rohr hat hier eine Sache am Laufen. Er verfügt über einen charakteristischen Stil und eine treue Fangemeinde. Welches Thema er auch aufgreifen mag, die Menschen können von ihm ein gewisses Etwas erwarten. In Der göttliche Tanz greift er die Dreieinigkeit auf.
Mal abgesehen davon, dass er das nicht tut. In diesem Buch – Der göttliche Tanz – geht es nicht um die Dreieinigkeit.
Das, worum es wirklich geht, ist der Fluss (vgl. oben den ersten Abschnitt). Rohr legt in diesem Buch eine Lehre vom göttlichen Fluss dar, und um seine Botschaft zu vermitteln, nimmt er einige Bruchstücke aus der christlich-theologischen Terminologie in den Dienst. Wenn das für dich zerstörerisch subversiv klingt, dann aus gutem Grund: Es ist zerstörerisch subversiv. Rohr zweckentfremdet in Der göttliche Tanz aktiv die Rede von der Dreieinigkeit, um seine zusammengewürfelte spirituelle Lehre an den Mann zu bringen.
Was immer in Gott geschieht
Wenn ich sage, dass Rohrs Buch nicht von der Dreieinigkeit handelt, dann ist das kein Versuch, ein Geheimnis zu lüften. Die Aussage ist nicht, dass er sich bemüht hat, ein Buch über die Dreieinigkeit zu schreiben, aber daran gescheitert ist. Sondern ich gebe so deutlich wie möglich wieder, was er auf den Seiten von Der göttliche Tanz selbst sagt. Wenn er über Dreieinigkeit schreibt (im engl. Original in der Regel ohne den bestimmten Artikel), dann lenkt er fortwährend unsere Aufmerksamkeit von den üblichen Aussagen und Kategorien der christlichen Lehre weg, hin auf eine dynamische Bewegung. „Was immer in Gott geschieht, ist ein Durchströmen, ein Ineinanderfließen“, schreibt er und erweitert diese Idee dann mit den Worten: „eine radikale Verbindung, eine vollkommene Gemeinschaft dreier Wesen – ein Kreistanz der Liebe“ (S. 18). Doch selbst das Tanzen ist noch zu konkret, schließlich lässt es an eine oder mehrere tanzende Personen denken. Rohr verändert also nochmals den Blickwinkel:
„Aber Gott ist nicht nur der Tänzer, er ist der Tanz selbst. Stelle Sie sich das vor! Das ist keine neue, trendige Theologie aus Amerika, sondern eine uralte Überlieferung. Traditioneller geht es kaum.“ (S. 18)
Als Nachweis, dass seine Lehre zutiefst traditionell sei, beruft sich Rohr auf das, was „die Wüstenväter so kühn erkannten“, nämlich „dass Gott … als lebendiger Beziehungstanz“ zu sehen ist; „im Griechischen heißt dies ‚perichoresis‘, und darin steckt unser heutiges Wort Choreografie“ (S. 22). Diese Aussage enthält zwei oder drei sachliche Fehler, aber lassen wir uns davon an dieser Stelle nicht stören.[2] Die wichtige Frage an Rohr und seine Leser lautet nicht, ob seine historischen Behauptungen vertrauenswürdig sind (ich würde sagen: nein). Es geht nicht einmal darum, ob er damit Recht hat, dass seine Lehre althergebracht ist und nicht neuzeitlich (ebenfalls nein). Das wirklich wichtige Thema ist, dass er sich hier die Möglichkeit verschafft, unter dem Deckmantel einer christlichen Lehre seine Metaphysik des Flusses zu vermitteln.
Die Drei geben den Fluss aus
Aus dem Zusammenhang gerissen, könnte man einige von Rohrs Sätzen als poetische Ausschmückung der christlichen Lehre verstehen. An einer Stelle sagt er: „Unser dreieiniger Gott ist ganz offensichtlich eine wilde Mischung aller möglichen Ausdrucksformen, die alle denkbaren Schubladen gleichzeitig überschreiten und einschließen“ (S. 72). Und an anderer Stelle: „Der trinitarische Strom ist wie das Steigen und Fallen der Gezeiten an einer Küste“ (S. 57). Könnte das eine bildhafte Art und Weise sein, um Gott oder vielleicht sogar Gottes Handeln mit der Welt zu beschreiben? Unabhängig vom Kontext, sicherlich. Der Lobpreis entlockt uns vielerlei blumige Ausdrucksweisen. Doch der nächste Satz verrät alles: „Alles Geschehen lässt sich als unendliches Ausströmen beschreiben, das eine ewige Umhüllung und Entfaltung ermöglicht und hervorbringt“ (S. 57).
Gerade dann, wenn er die Rede von der Dreieinigkeit verwendet, um die Aufmerksamkeit von Gott weg auf eine größere Realität zu lenken, die sowohl Gott als auch die Welt umfasst, beginnt Rohr sich für sein eigentliches Thema zu begeistern:
„Wichtig ist dabei, dass die Drei durch das Ausströmen und ungehinderte Fließen selbst gebildet und definiert werden. Dieses Fließen formt und schützt die Drei, und die Drei geben den Fluss aus. Dieselbe Dynamik gibt es auch in einer gesunden Gesellschaft, nicht wahr?“ (S. 72)
Was ist größer als die Dreieinigkeit? Was war vor ihr, was ist umfassender, grundlegender? Worauf gründet all ihre Güte, was ist ihr Lebensspender? Welche größere Realität gibt dem Vater, Sohn und Heiligen Geist ihre Gestalt, macht sie zu dem, was sie sind? Was bewahrt sie, was vereint sie unauflöslich nicht nur miteinander, sondern auch mit der geschaffenen Welt? Im Rahmen der christlichen Lehre zeigen solche Fragen eine massive Orientierungslosigkeit des Fragenden, und die Antwort lautet: „Nichts, absolut gar nichts.“ Doch Der göttliche Tanz gibt eine andere Antwort. In, mit und unter den drei Personen gibt es eine Beziehungsmatrix, in welcher die drei Personen lediglich Knotenpunkte sind, um die die geistliche Kraft zusammenfließt. Rohr sagt: Konzentriere dich darauf.
Die Energie und Qualität der Beziehung
Schließlich geht es bei der Dreieinigkeit gar nicht um Vater, Sohn und Heiligen Geist. Rohr räumt ein: „Für unseren Verstand ist es hilfreich, drei Personen zu identifizieren“ (S. 78). Aber „selbst die drei Namen sind eigentlich nur Platzhalter, und es gibt tausend schöne Namen für Gott, mit denen man sie austauschen könnte“ (S. 79). Was ist dann das Wichtigste? „Das Wichtigste ist, die Energie und die Qualität der Beziehung zwischen diesen Dreien zu begreifen. Denn genau dieses existentielle Mysterium verwandelt uns“ (S. 79). Der Untertitel von The Divine Dance lautet: The Trinity and Your Transformation (Die Dreieinigkeit und deine Verwandlung). Dabei ist das „and“ erstaunlich bedeutsam. Es gibt eine unermesslich große, alles umfassende Realität (den Tanz), der nicht nur die Dreieinigkeit, sondern auch deine Verwandlung hervorbringt. Diese Realität ist das Eine, das größer ist als Gott, denn sie umgibt sowohl ihn als auch dich. Tatsächlich glaubt Rohr, dass genau diese Kraft wirkt, um bei seinen Lesern ihren Moment des Erwachens herbeizuführen, wenn sie die Botschaft seines Buches lesen: „Ob bewusst oder unbewusst, was Sie an diesen Seiten anzieht, bringt das Geheimnis des trinitarischen Flusses – der wildesten Welle – auf eine höhere Bewusstseinsebene“ (S. 149).
Um diesen Punkt zu unterstreichen, wirft Rohr bezüglich der Dreieinigkeit die Frage auf: „Ist es ein Junge oder ein Mädchen?“ (S. 81). Natürlich hat diese Frage einen scherzhaften Unterton; Rohrs spitzbübischer und hämischer Sinn für Humor gehört zu den erfreulichsten Aspekten seines Schreibstils. Aber hier fragt er im Anschluss ernsthaft, „warum die Sprache, mit der wir über Gott reden, so maskulin ist“ (S. 81). Aus seiner Sicht müssen Christen mit der Tatsache leben, dass uns eine patriarchale antike Kultur maskuline Namen für Gott mitgegeben hat, mit denen wir in der Bibel arbeiten. Und für ihn ist selbstverständlich, dass wir diese mit femininen Namen ergänzen sollten. Doch in der Dreieinigkeit findet er das, was er braucht, um einen noch größeren Schritt zu gehen:
„Aber wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass die Zwischenräume zwischen den einzelnen Personen der Dreieinigkeit eindeutig weiblich sind. Ihre festen Formen oder Manifestationen sind die maskuline Dimension und das diffuse, intuitive, geheimnisvolle und wunderbare Unbewusste dazwischen ist weiblich. Und dort liegt die wahre Macht – im Raum zwischen den Personen viel mehr als bei den einzelnen Personen selbst.“ (S. 81)
Übersieh, wenn du kannst, die Anbetung einer Göttin; das ist ein Allerweltsirrtum, den jeder erkennen kann. Übersieh ebenfalls, wenn du kannst, die gnostisch-Jung’schen Vorannahmen, die nötig sind, um ein „diffuses, intuitives, geheimnisvolles und wunderbares Unbewusstes“ mit archetypischer Weiblichkeit zu identifizieren; das ist einfach das Fahrwasser der Mode-Spiritualität der Boomer-Ära im (amerikanischen) Südwesten. Übersieh, wenn du kannst, das Schriftverständnis, nach welchem den Lesern zusteht, sich zu Richtern über die inakzeptable Sprache und die kulturelle Rückständigkeit der Bibel aufzuschwingen; das ist im Großen und Ganzen nur die etablierte Ansicht der liberalen Theologie. Das alles sind Ablenkungen. Aber du solltest auf jeden Fall bemerken, dass dieses Buch, in dem es angeblich um die Dreieinigkeit geht, unablässig damit beschäftigt ist, deine Aufmerksamkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist wegzulenken.
Die vierte Person der Dreieinigkeit
Der göttliche Tanz relativiert die drei Personen der Dreieinigkeit. Sie sind nicht einmal Inseln in einem größeren Strom; sie sind herumwirbelnde Muster in einem Ozean der Relationalität. Wenn du diese Prämisse geschluckt hast, lädt Rohr dich ein, die nächste Einsicht zu empfangen: Der Ozean hat Raum für weitere herumwirbelnde Muster. Der Fluss kann ein viertes einbinden. Er muss es sogar.
Um diesen Punkt so eindrücklich wie möglich zu machen, unternimmt Rohr eine gewagte Sache. Das dominierende Bild in diesem Buch ist Andrei Rubljows Dreifaltigkeitsikone, entstanden etwa 1425 (die Dreifaltigkeit wird mystisch dargestellt durch die drei Männer, die Abraham in 1. Mose 18 besuchten). Rohr legt dar, wie die drei Gestalten, die um einen Tisch sitzen und sich dem Betrachter zuwenden, den Betrachter zu einer Art Teilnehmer in ihrer gemeinschaftlichen Runde zu machen scheinen. Das ist eine gute Beobachtung, über die es sich nachzudenken lohnt und die schon häufig gemacht worden ist.
Aber für Rohrs Geschmack ist das zu subtil. Er unternimmt einen bemerkenswerten Sprung und erklärt, dass ein dunkleres Rechteck vorne am gemalten Tisch den Betrachter noch direkter einbeziehen sollte:
„Die meisten Betrachter übergehen es, aber Kunsthistoriker sagen, dass es an dieser Stelle Klebstoffreste gibt, die darauf hindeuten, dass dort vielleicht einmal ein Spiegel war.“ (S. 22)
Diese Aussage enthält zwei oder drei sachliche Fehler, aber lassen wir uns davon an dieser Stelle nicht stören.[3] Der Punkt ist, dass das Bild von Gott nicht vollständig ist, solange wir nicht miteingefügt sind. Rohr möchte, dass wir uns selbst als Teil der Dynamik betrachten, die über Gott steht. Es gibt „a (w)hole in God“ (eine Lücke in Gott), wie eine Kapitelüberschrift lautet.[4] Rohr staunt:
„Einige Mystiker, die ein besonders intensives Gebetsleben pflegten, haben diese Idee zu Ende gedacht. Für sie ist die Schöpfung die vierte Person der Dreieinigkeit. Ich habe es schon gesagt: Der göttliche Tanz findet nicht in einem geschlossenen Kreis statt, wir sind alle eingeladen.“ (S. 57)
Falls irgendetwas von dem Gesagten bei dir im Kopf die Irrlehre-Alarmglocken schrillen lässt (und ich hoffe, dass sie schrillen), warnt dich Rohr:
„Natürlich klingt das alles nach Ketzerei, vor allem für verschlossene Herzen, die alles allein machen wollen. Aber es ist eben auch der vierte Platz, der in Andrei Rubljows Dreifaltigkeitsikone aus dem 15. Jahrhundert mit einem Spiegel reserviert ist.“ (S. 58)
Dieses Buch, in dem es nicht um die Dreieinigkeit geht, ist sehr bemüht, zumindest an dieser Stelle Dreiheit zu thematisieren. Wenn Rohr über unsere Aufnahme in die Dreieinigkeit spricht, verwendet er eine Art simple Zahlenmystik. Sein metaphysisches Prinzip besteht in der Auffassung, „dass ‚die Verwebung der drei [immer] ein Viertes erschafft‘. Wenn auch auf einer anderen Ebene“ (S. 58). Eins ist einsam, Zwei ist Rivalität, aber Drei ist dynamisch und transzendent. Aus drei wird vier. Dreiheit bewirkt, dass du in Gott einbezogen wirst.
Arme, übersehene Dreieinigkeit
Auf den ersten Seiten von Der göttliche Tanz klagt Rohr, die Lehre von der Dreieinigkeit sei der modernen Kirche abhandengekommen. Und er macht sich daran, eine „gewagte Lehre abzustauben“.[5] Unglücklicherweise beginnen so ziemlich viele Bücher über die Dreieinigkeit und viele versprechen ein Heilmittel für dieses „Trinitäts-Defizit-Syndrom“ (Rohrs nette Wortschöpfung; S. 130), das in der Kirche angeblich weit verbreitet ist. Doch wenn man eine solche Geschichte erzählen will, hängt eine Menge von den Details ab: Wann war die Lehre noch intakt? Wann wurde sie dysfunktional? Wann wurde sie wiederbelebt? Ich würde zwar generell empfehlen, von solchen Aufstieg-und-Niedergangs-Erzählungen abzusehen. Aber ich wäre zumindest bereit, eine Version der Geschichte zu glauben, die besagt, die Christen hätten irgendwann um 1880 zeitweilig den Zugang zur Kraft dieser Lehre verloren – schließlich setzte die Hochmoderne dem Glauben schwer zu.
Doch Rohr hat eine andere Geschichte im Kopf. In seiner Version von „Liebling, ich habe die Trinität geschrumpft“ schlummerte diese Lehre praktisch vor sich hin, „bis William Paul Young vor zehn Jahren seinen Roman Die Hütteschrieb, der ein Weltbestseller wurde. Zum ersten Mal seit dem 4. Jahrhundert wurde die Dreieinigkeit tatsächlich zu einem inspirierenden Gesprächsthema, das an heimischen Küchentischen und in Restaurants aufs Angeregteste diskutiert wurde und interessante Fragen aufwarf. Und es geht immer weiter!“ (S. 16). Damit haben wir unsere Jahreszahlen, nämlich 381 n.Chr. bis 2007, und der Held dabei ist Young (der sich mit einem überschwänglichen Vorwort revanchiert hat). Das ist eine Menge Staub, wenn man eine gewagte Lehre abstauben will!
Rohr zeigt sich selbst erstaunt: „Aber wie kann es sein, dass die Dreieinigkeit 17 Jahrhunderte lang quasi verschollen war?“ (S. 16). Tatsächlich, hier wird die Gutgläubigkeit ziemlich strapaziert. Also akzeptieren wir doch einfach, dass das nicht glaubwürdig ist. Man kann nur dann glauben, Rohr habe die Dreieinigkeit wiederentdeckt, wenn man auch bereit ist zu glauben, dass dieser fremde Inhalt, den er der Lehre verpasst, die echte Wahrheit ist. Und dass Augustinus, Johannes von Damaskus, Aquinas, Bonaventura, Calvin, Wesley und Barth nur an einigen Nebengleisen herumgebastelt haben (dem Aquinaten gesteht Rohr immerhin in einem Anfall von Großzügigkeit zu, dass er „der Wahrheit ein ganzes Stück näher“ kam; S. 37). Diese umnachteten Seelen (wahrscheinlich hatten einige von ihnen „verschlossene Herzen, die alles allein machen wollen“; S. 58) und auch all die anderen Pastoren, Prediger, treuen Frauen und Männer während der meisten Jahrhunderte der kirchlichen Pilgerreise – was sie die ganze Zeit über zu sagen versuchten, aber nie richtig zuwege brachten, bis Die Hütte kam, ist: Im Anfang war der Fluss.
Wie kam es zu diesem epochalen Augenblick, in dem Rohr zur Deutung der Dreieinigkeit als Fluss durchdrang? Er verbrachte eine Fastenzeit in einer Einsiedelei in Arizona. Eigentlich hatte er nicht vor, etwas anderes als die Bibel zu lesen, aber dort in der Bibliothek hatten sie Catherine Mowry LaCugnas einflussreiches Buch God for Us: The Trinity and the Christian Life (Gott für uns: Die Dreieinigkeit und das christliche Leben). Er begann zu lesen, wohl wissend, dass es „schwer zu lesen und manchmal sogar langweilig“ ist (S. 33). Und während des Lesens, auch wenn er „bei Weitem nicht alles verstand“, rief er „innerlich ständig: ‚Ja! Ja!‘ So viele neue Worte und kaum durchschaute Ideen!“ (S. 32). Als er mit dem Buch fertig war, sah er die Dreieinigkeit „nicht mehr als abstrakte Idee, als Lehrmeinung oder gelochter und abgehefteter ‚Glaube‘, sondern als eine Art Phänomenologie der eigenen und fremden inneren Gotteserfahrungen“ (S. 32). Das war überwältigend: „Auf einmal war die Dreieinigkeit kein vager Glaube mehr, sondern eine objektive Art, meine eigenen tiefsten Erfahrungen mit Gott zu beschreiben – und mit dem, was ich hier als Strom bezeichne“ (S. 32). Als er von dieser Lehrstunde nach Hause fuhr, „konnte ich den Strom viel mehr genießen, den ich überall fließen sah“ (S. 33). Gewiss ist er überall in Der göttliche Tanz geflossen.
God for Us von LaCugna ist ein sehr gelehrtes, aber auch sehr fehlerbehaftetes akademisches Werk. Es erregte 1993 großes Aufsehen, was aber nicht lange anhielt. Wie Rohr selbst bekennt und wie Der göttliche Tanz zeigt, verstand er nur recht wenig davon. Er übernahm nur die problematischsten Teile und kanalisierte dieses ganze Erlebnis in seine prä-existente Metaphysik des Flusses. Seine Einsichten formulierte er bei einer Reihe von Vorträgen, die aufgezeichnet wurden. Co-Autor Mike Morrell verschriftlichte und überarbeitete sie für dieses Buch. Stilistisch gesehen ist die Übertragung dieses Materials von der Rede zur Schrift kein besonders glückliches Unternehmen. Das Buch ist diffus, weitschweifig und redundant. In ein paar andächtigen Abschnitten hat das eine entwaffnende Wirkung. Doch der saloppe und nachlässige Stil wird auch beibehalten, wenn Rohr Dinge behauptet, die belegt oder präzisiert werden müssten.
Ich erwähne die ungewöhnliche Entstehung des Buches, weil mir das zu verstehen half, warum Der göttliche Tanz so klingt, wie es klingt. Im Hintergrund steht die impressionistische Lektüre eines problembehafteten theologischen Buches, weitergegeben dann in einer Reihe von unterhaltsamen, ansprechenden Vortragseinheiten, wie sie wahrscheinlich nur im Rahmen einer spirituellen Einkehrzeit funktionieren – und das Ganze schließlich verwoben zu einem oberflächlichen Buch mit vielen ausgefransten Behauptungen und losen Enden.
Lektionen, die man lernen sollte?
Was können wir über Der göttliche Tanz sagen? Rohr sichert sich selbst gegen Kritik ab, indem er fortlaufend kleine imaginäre Wortwechsel einstreut, in denen er kritisiert wird. Er zitiert 1. Johannes und sagt dann: „Wenn ich das gesagt hätte, würde man mich sicher einen leichtfertigen Esoteriker nennen. Doch ich teile nur Johannes’ tief trinitarische Theologie – mit all ihren Implikationen. Das ist wahrer Traditionalismus“ (S. 71). Das nimmt dem Rezensenten den Wind aus den Segeln, der feststellen wollte, dass Rohrs Lehre deutlich von der Tradition abweicht, und zwar exakt in die Richtung von leichtfertigem Esoterikkram. Eine Art fromme Blasphemie ist Rohrs Markenzeichen. Das Flirten mit der Häresie macht seine Faszination aus. Er scheut keine Mühe, eigenwillig, buddhistisch, wissenschaftlich, unorthodox zu klingen.
Gelegentlich gibt es Abschnitte, in denen ich ihm zustimmen kann, oder zumindest sehe, dass er sich mit etwas befasst hat, über das ich mehr lernen möchte. Aber diese Abschnitte zerschellen unweigerlich an höchst verwerflichen Passagen. Zum Beispiel legt Rohr auf ein oder zwei Seiten nahe, Hunde und Kinder zu knuddeln. Das erwärmt seltsamerweise sogar mein verschlossenes Herz, das alles allein machen will. Doch schon die nächste Zeile sagt über diese kuscheligen Freunde, dass „sie in diesem Moment – ich bitte um Entschuldigung! – Gott sind. Oder ist es eigentlich anders herum? Werden wir zu Gott, wenn wir in einem so ungehemmten Fluss stehen?“ Und er schließt mit der Feststellung: „Natürlich ist beides richtig“ (S. 70). Aber beides ist falsch.
Und meine lange – ich bitte um Entschuldigung! – Rezension hat einen Hauptpunkt: In Der göttliche Tanz geht es nicht um Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es ist ein Buch über eine alternative Spiritualität des Flusses, ist einer Metaphysik verpflichtet, die sich weigert, einen Unterschied zwischen Gott und der Welt zu erkennen. Es handelt sich um eine einzige große Vereinnahmung der theologischen Rede von der Dreieinigkeit, mit dem erklärten Ziel, dieses Vokabular zur Einführung einer gänzlich neuen Lehre zu benutzen. Ich hätte die Lehre vom göttlichen Fluss in jedem Kontext abgelehnt, wo auch immer sie mir begegnet wäre. Aber dass diese Lehre als die christliche Dreieinigkeitslehre vermarktet wird, ist unerträglich. Und diese kontinuierlich falsche Darstellung macht das Buch zu einem Stück Irrlehre in der Gemeinde.
„Wenn du einem Lehrer im Hinblick auf die christliche Gotteslehre nicht vertrauen kannst, dann kannst du ihm nicht vertrauen. Punkt.“
Ich sage das mit einer gewissen Zurückhaltung, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen weiß ich, dass viele Evangelikale die eine oder andere Erfahrung mit Richard Rohr gemacht haben und sagen, dass sie von seinen spirituellen Schriften profitiert haben. Zum anderen habe ich keines seiner früheren Bücher gelesen, daher kann ich mich nicht auf eine umfassende Untersuchung seiner Gesamtposition stützen.
Aber was ich hier in Der göttliche Tanz lese, ist wirklich schlecht. Am Rande zeigen sich verräterische Anzeichen von Allversöhnung, zeigt sich die Ablehnung des Gedankens, dass Christi Tod für unsere Versöhnung mit Gott notwendig war, außerdem eine abwertende Sicht der Schrift als einem moralisch befleckten Text mit falschen Aussagen, und die Idee, dass die Inkarnation an sich schon Versöhnung mit Gott bedeutete. Im Zentrum des Buches steht ein absichtlicher Missbrauch der Dreieinigkeit. Das Buch zielt darauf, die christliche Lehre vom dreieinigen Gott zu untergraben und zu ersetzen. Es ist ein theologisches Trojanisches Pferd, mit dem eine feindliche Metaphysik mitten in die Gemeinde gebracht werden soll.
Wenn du von der geistlichen Lehre in Rohrs früheren Büchern profitiert hast, dann nimm dir doch einen Moment Zeit, um neu zu überlegen, ob du dich der Lehre einer solchen Person unterstellen solltest. Mein Rat ist, es nicht zu tun. Danke Gott, dass du durch sein Werk zu etwas Gutem angeregt wurdest, aber nimm zur Kenntnis, dass er ein anderes Evangelium mit einem anderen Gott verkündigt. Was auch immer er Wahres sagt, kann sicherlich auch anderswo gefunden werden, bei einem Autor, der nicht die Dreieinigkeit in einen göttlichen Fluss hineinmanövriert.
Wenn du einem Lehrer im Hinblick auf die christliche Gotteslehre nicht vertrauen kannst, dann kannst du ihm nicht vertrauen. Punkt.
Wenn deine Freunde oder Verwandten Rohrs Materialien für ihr geistliches Leben verwenden, dann warne sie davor. Die amerikanische Originalausgabe beginnt mit sechs Seiten Empfehlungen von bekannten Persönlichkeiten; betrachte diese als Menschen mit mangelhaftem Unterscheidungsvermögen, denen die Qualifikation fehlt, um geistliche Bücher empfehlen zu können. Das ist keine Sache, bei der man herumexperimentieren sollte.
Du bist nicht das vierte Mitglied der Dreieinigkeit, es gibt keine Beziehungsmatrix, die die Drei formt und schützt, und dieses Buch enthält keine gesunde christliche Lehre.
[1] Diese und alle weiteren Seitenzahlen beziehen sich auf das deutsche E-Book.
[2] (1) Die Väter haben die Dreieinigkeit nicht als Tanz bezeichnet. Vielleicht würde sich irgendein poetisch veranlagter Kirchenvater finden lassen (Romanos Melodos? Ephräm der Syrer?), der das Bild vom Tanzen für die Dreieinigkeit verwendet hat. Aber das ist immer noch weit entfernt davon zu sagen, die Dreieinigkeit sei ein Tanz, dass Gottes-Sein Tanz-Sein ist. Versuche einfach mal, dir einen der Alten vorzustellen, der das sagt. Man findet die Idee vielleicht schon zur Zeit eines William Butler Yeats (der die Frage stellte: „Wie können wir den Tänzer vom Tanz unterscheiden?“), aber ich vermute, dass sie ihren Weg in die modernen Dreieinigkeits-Andachten durch eine neuere Quelle gefunden hat. Mit „Maniac“ aus dem Soundtrack zum Film „Flashdance“ (1983) dürfte man in der richtigen Epoche sein. (2) Wenn die Kirchenväter das Wort „perichoresis“ verwendeten, sprachen sie nicht vom Tanzen. (3) Dieses Wort hat auch nichts mit der Herkunft unseres Begriffs „Choreografie“ zu tun (das wäre choreuo, nicht choreo). Ist es ein wenig pedantisch, darauf hinzuweisen, dass Rohr sich der Verbreitung moderner etymologischer Legenden schuldig macht? Wahrscheinlich. Aber hätte nicht jemand aus seinem Team einen Faktencheck durchführen müssen, bevor man diesen Mythos übernimmt und „göttlicher Tanz“ auf das Cover schreibt? Die Tatsache, dass das keinen gekümmert hat, ist symptomatisch für die chronische Nachlässigkeit des gesamten Projekts, die sich in seinen Aussagen zu Kunst, Wissenschaft, Philosophie, Geschichte und biblischen Themen zeigt.
[3] (1) Kunsthistoriker sagen das nicht. Sie würden es wohl auch nicht sagen, denn (2) die Ikone blickt auf eine komplizierte Geschichte wiederholter Restaurierungen zurück, die sehr viele Schichten von Farbe und Firnis hinterlassen haben (insbesondere die Restaurierungen von 1906 und 1919). Somit ist schwer zu sagen, worauf sich Rohrs „Klebstoffreste“ auf der originalen Ikone beziehen sollten. Und (3) wäre die Anbringung eines Spiegels derart außergewöhnlich, dass kein Kunsthistoriker das in Betracht ziehen würde, ohne positive Indizien für eine solche Option zu haben (wie einen Spiegel, der auf einer Ikone angebracht ist, oder einen alten Text, der besagt: „Auf der Ikone war ein Spiegel angebracht“). Rohr redet hier wie jemand, der weiß, dass er die Wahrheit hinbiegt, denn er sagt Dinge wie: „Der Spiegel scheint irgendwann im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen zu sein“ (S. 23) und „Normalerweise würde man eine heilige Ikone nicht mit einem echten Spiegel versehen. Wenn es so wäre, dann wäre das wirklich einzigartig und sehr mutig“ (S. 23). Diese erdichtete Kunstgeschichte-Story gehört zu der Art von Stammtischweisheiten, die man nur dann an den Mann bringen kann, wenn niemand in der Kneipe einen Internetzugang zur Hand hat. Schon der (englischsprachige) Wikipedia-Artikel über Rubljows Dreifaltigkeitsikone reicht, um die Geschichte zu widerlegen (halte dort nach dem Wort „riza“ Ausschau und denke kurz darüber nach). Dass es ein Seemannsgarn wie dieses in den Druck geschafft hat, erweckt kein Vertrauen in die Lektorate und Verlage, die für The Divine Dance/Der göttliche Tanzverantwortlich sind.
[4] Die deutsche Ausgabe gibt die Überschrift zurückhaltender mit „Eine Lücke im Ganzen“ wieder (S. 22).
[5] So eine Kapitelüberschrift: „Dusting Off a Daring Doctrine“, die im Deutschen mit „Staub aufwirbeln erwünscht“ wiedergegeben wird.