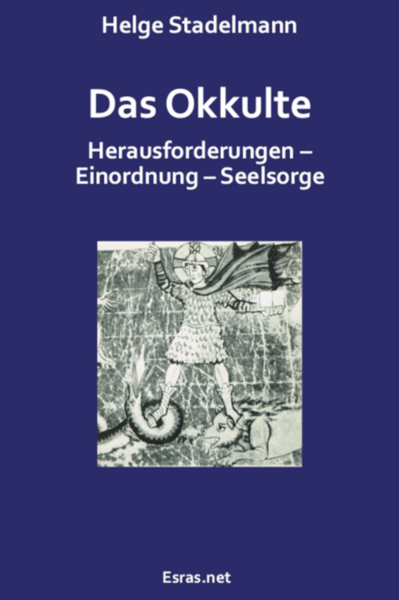
Das Okkulte
Es ist nicht alltäglich, dass ein Buch nach fast 40 Jahren (1. Aufl. 1981; 2. Aufl. 1984) aus der Versenkung geholt, von seinem Autor beträchtlich erweitert (von ursprünglich 63 S. auf nun 179 S.) und neu herausgegeben wird. Dabei äußert sich Stadelmann gleich zu Beginn des neuen Vorworts zum Stellenwert des Themas: „Okkultismus gehört nicht ins Zentrum. Ins Zentrum gehört Gott, nicht das Widergöttliche“ (S. 7). Warum dann trotzdem die Mühe? Kurz gesagt: Weil Menschen in den Dunstkreis okkulter Phänomene geraten und seelsorgerliche Hilfe benötigen. Und weil solche Hilfe auf einem soliden biblischen Fundament stehen sollte.
„Warum dann trotzdem die Mühe? Kurz gesagt: Weil Menschen in den Dunstkreis okkulter Phänomene geraten und seelsorgerliche Hilfe benötigen.“
Die Dreiteilung des Buches folgt dieser seelsorgerlich-theologischen Zielsetzung. Im ersten Teil geht es um die Wahrnehmung der Herausforderungen. Überblicksartig und zugleich mit vielen Beispielen wird ein Spektrum aufgezeigt, mit welchen Formen von Grenzerfahrungen, Übersinnlichem und Paranormalem Menschen heute zu tun haben. Hierzu gehören Aberglaube, Mantik (Wahrsagung) und Magie, durch die der Mensch Wissen, Schutz und Macht zu erlangen sucht. Ähnlich zielt die Esoterik mit ihren vielen Spielarten darauf ab, sich spirituelle Kräfte aus der unsichtbaren Welt für das Leben in der sichtbaren Welt zunutze zu machen – u.a. im Bereich der alternativen Medizin. Im Spiritismus wird auf verschiedenen Wegen der Kontakt zu Geistwesen und Toten gesucht; Satanismus und Hexentum (Wicca-Bewegung) erfreuen sich neuer Popularität. Zuweilen wird das Schamanentum der animistischen Völker von Westlern romantisch verklärt, doch die alltägliche Realität dieser Kulturen ist ernüchternd: Sie ist geprägt von mancher Quacksalberei und v.a. von einer ständigen Angst vor Schadzauber und missgünstigen Geistern.
Der erste Teil schließt mit zwei wichtigen Themenkreisen ab. Zum einen kommt es vor, dass auch von Christen Gedankengut propagiert wird, das sich bei Licht besehen kaum von esoterischem Denken unterscheidet. Solcher „Semi-Okkultismus“ im christlichen Gewand begegnet im Bereich der Heilung oder auch in einer über die Bibel hinausgehenden Beschäftigung mit der übernatürlichen Welt (z.B. in der geistlichen Kriegführung). Auf der anderen Seite interessiert sich auch die Wissenschaft (im Forschungsgebiet der Anomalistik) für die gar nicht so selten auftretenden übersinnlichen Phänomene und sie sucht nach Erklärungen. Die geäußerten Theorien, die sich z.B. auf Ideen C.G. Jungs oder Mutmaßungen zur Quantenphysik stützen, bleiben aber letztendlich einem rein immanenten Weltbild verhaftet.
Der zweite Teil des Buches widmet sich der biblischen Einordnung. Übersichtlich und präzise wird analysiert, welche Formen von okkulten Phänomenen in der Bibel erscheinen bzw. was diese dazu sagt. Das betrifft einerseits okkultes Handeln, in dem der Mensch aktiv wird, weil er „sein Begrenztsein überlisten will und zu seinem Vorteil zu handeln versucht“ (S. 78). Dies lässt sich den drei Bereichen Abgötterei, Wahrsagung und Zauberei zuordnen, welche aber auch immer wieder in Kombination vorliegen (z.B. 2Kön 17,16–17). Die Palette reicht von den Kinderopfern für den Götzen Moloch über Astrologie bis zur abergläubischen Verehrung von Moses eherner Schlange (vgl. 2Kön 18,4), vom babylonischen Pfeilorakel (vgl. Hes 21,26–27) über die Magd mit dem Wahrsagegeist (vgl. Apg 16,16) bis zu Sauls Besuch bei der Totenbeschwörerin und zu den ägyptischen Zauberern, die die von Mose getätigten Wunder nachzuahmen suchten. Dabei lässt die Bibel keinen Zweifel daran, dass Gott diese Praktiken ablehnt (z.B. 2Mose 20,2–6; 5Mose 18,9–12.14).
„Zwar bezeugt die Bibel den (realen) Widerstreit zwischen Licht und Finsternis, aber sie lehrt keinen Dualismus – es gibt kein unentschiedenes Ringen zwischen Gut und Böse.“
Andererseits begegnet in der Bibel auch okkultes Erleben: Einem Menschen widerfahren übersinnliche Dinge, die er nicht gesucht hat, sondern denen er offenbar ausgeliefert ist. Dies betrifft v.a. Besessenheitsphänomene, die in verschieden starker Ausprägung von einer Umsessenheit bis zur Inbesitznahme eines Menschen durch einen Dämon (Besessenheit) auftreten können. „Die wichtigste Lehre des Neuen Testaments über die Besessenheit ist aber die, dass es in Jesus Befreiung von ihr gibt!“ (S. 108). Im NT finden sich auch Hinweise zum konkreten Vorgehen – das sich deutlich von magisch verstandenen Beschwörungspraktiken (wie denen, die von jüdischen Exorzisten verwendet wurden) unterscheidet.
Anschließend wird das Okkulte noch aus einer weiteren theologischen Perspektive, nämlich durch die Brille der Dogmatik in den Blick genommen. Entgegen modernen Erklärungsversuchen gibt die biblische Anthropologie keinen Anlass zu der Annahme, der Mensch verfüge natürlicherweise über übernatürliche Fähigkeiten. Die Dämonologie zeigt, dass die Bibel mit einer transzendenten Realität und konkret mit der Existenz und dem Wirken von Dämonen rechnet. Der Versuch, die biblischen Berichte zu entmythologisieren – sie auf modern-rationale Weise immanent zu deuten –, entspringt einem auf das Diesseits begrenzten Weltbild (vgl. auch S. 13: „Wer die Existenz des Bösen und der gottwidrigen Mächte leugnet, wird das Evangelium nicht verstehen“). Die Hamartiologie legt offen, dass okkulte Praktiken Sünde sind, für die Gott den jeweiligen Menschen zur Verantwortung ziehen wird. Die Soteriologie macht klar, dass in Jesus Erlösung und Befreiung zu finden ist, dass diese aber notwendig eine Abkehr von allen finsteren Mächten und Praktiken und die Hinkehr zu Gott beinhaltet. Zu guter Letzt zeigt die biblisch-theologische Einordnung: Zwar bezeugt die Bibel den (realen) Widerstreit zwischen Licht und Finsternis, aber sie lehrt keinen Dualismus – es gibt kein unentschiedenes Ringen zwischen Gut und Böse. Gott ist und bleibt der Herr (mit Luther: auch der Teufel ist nur „Gottes Teufel“; S. 146). Die Bibel gibt den dunklen Mächten keine „große Bühne“ (S. 145), sie sind in Christus besiegt. „Auch wenn es um das Okkulte geht, dürfen nicht der Teufel und seine Mächte im Mittelpunkt stehen. [...] Nur von Gottes Allmacht und vom Sieg Christi her ist das Okkulte zu sehen“ (S. 147).
Im dritten und letzten Teil des Buches wird es dann praktisch: Wie kann nun konkret in der Seelsorge vorgegangen werden? Wesentlich ist, dass der Seelsorger die Situation angemessen einschätzt. Möglicherweise sind Menschen nicht schuldhaft in okkulte Zusammenhänge verstrickt, sondern erleben nur Anfechtungen aus diesem Bereich. Es muss geklärt werden, ob womöglich statt einer okkulten Belastung eine psychische Erkrankung vorliegt, für die dann der Facharzt zuständig ist. Wenn wirklich Befreiung benötigt wird, dann führt der Weg über Sündenerkenntnis, -bekenntnis und Umkehr. Jesus hat seine Nachfolger bevollmächtigt, in seinem Namen den Mächten zu gebieten, damit Menschen frei werden. Solche Befreiung beruht völlig auf der Macht und dem Sieg Jesu, daher sind im sog. Befreiungsdienst weder aufplusterndes und lautes Verhalten noch die Anwendung spezieller Formeln nötig. Grundsätzlich ist stets zuvor das Einverständnis des Betroffenen einzuholen.
Das Okkulte ist das seelsorgerliche Buch eines Theologen. Dabei kommt weder das theologische noch das seelsorgerliche Anliegen zu kurz, sondern sie ergänzen sich so, wie sie es generell tun sollten. Schließlich liegt der Sinn der theologischen Arbeit nicht in der Konstruktion von Gedankengebäuden; andererseits zeigt sich leider immer wieder, dass die Seelsorge ohne gutes biblischtheologisches Fundament zum blinden Blindenführer wird.
„Offene Fragen stellen weder unsere Beziehung zu Gott, noch seine Allmacht und Liebe grundsätzlich in Frage.“
Entsprechend der Intention des ersten, „zuhörenden“ Teils sollte man dort kein Nachschlagewerk erwarten, in dem griffbereit Antworten zu finden sind, wie einzelne Phänomene aus christlicher Perspektive einzuschätzen sind. Gerade bei den „weicheren“ Bereichen wird tatsächlich beschrieben, nicht gewertet (im Bereich der alternativen Heilverfahren hätte ich mich trotzdem über einen klareren Hinweis zur Einschätzung gefreut, da es gerade auf diesem Gebiet unter Christen viel Sorglosigkeit und auch einige Unsicherheit gibt; allerdings kann das ein Exkurs wie der hier vorliegende vielleicht auch einfach nicht leisten). Deutlichere Einschätzungen klingen dann bei den „härteren“ Spielarten durch – wenn beispielsweise im Zusammenhang mit dem Satanismus festgestellt wird, dass finstere Symbolik in manchen Subkulturen einfach auch „in“ ist; dennoch müsse gefragt werden, wie weit es unbeschadet möglich sei, mit dem zu kokettieren, was für Gott ein Gräuel ist (vgl. S. 39).
Trotz des an sich unerfreulichen Themas ist es eine Freude, die klar strukturierte biblische Analyse im Mittelteil des Buches zu lesen. Bibelstellen werden nicht überstrapaziert, aber ihre Aussagen zum Thema verständlich auf den Punkt gebracht. Herausfordernde Fragen werden nicht umgangen, sondern gestellt und so weit als möglich beantwortet (Handelt nicht z.B. Jakob auf magische Weise, als er abgeschälte Holzstäbe in die Tränkrinnen der Herden legt, damit sie gefleckte Jungtiere werfen [vgl. 1Mose 30,25–43] – was Gott aber nicht tadelt, sondern gelingen lässt? Oder: Wie ist es denn mit der Schuld der Väter, die offenbar auf die Kinder übergeht?).
Besonders im letzten Teil des Buches wird deutlich, dass der Autor selbst über einige Erfahrung im Bereich der Okkultseelsorge verfügt. Diese fließt u.a. in Beispielen mit ein. Dabei wird die Möglichkeit okkulter Belastung weder groß noch kleingeredet. Vor allem aber wird beharrlich darauf hingewiesen, dass Gott bzw. Christus im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen sollte, nicht die finsteren Mächte.
Obwohl das Buch gut verständlich geschrieben ist, ist es alles andere als oberflächlich, sondern bietet eine Fülle an detaillierten Informationen – beispielsweise, was es mit Josefs Wahrsagebecher (vgl. 1Mose 44,5) auf sich haben könnte. Sehr aufschlussreich ist auch der Exkurs über C.G. Jungs Werdegang (S. 67–74).
Für wen ist das Buch geeignet? Selbstverständlich für Seelsorger – schließlich kann es jederzeit geschehen, dass sich Menschen in okkulten Verstrickungen hilfesuchend an sie wenden. Darüber hinaus aber auch für Pastoren, Älteste und eigentlich jeden Christen. Wir leben in einer Welt, die sich nach der Nüchternheit der Moderne zunehmend fasziniert vom Übersinnlichen zeigt; das ist Teil unseres Alltags. Daher benötigen wir vermutlich hier oder da einen Augenöffner, vor allem aber ein solides Fundament, um die Dinge aus biblischer Perspektive einordnen und weise damit umgehen zu können.
Buch
Helge Stadelmann. Das Okkulte: Herausforderungen – Einordnung – Seelsorge. Niederbüren (CH): Esras.net, 2020, 3. stark erweiterte & aktualisierte Auflage. 179 Seiten, 17,99 Euro.