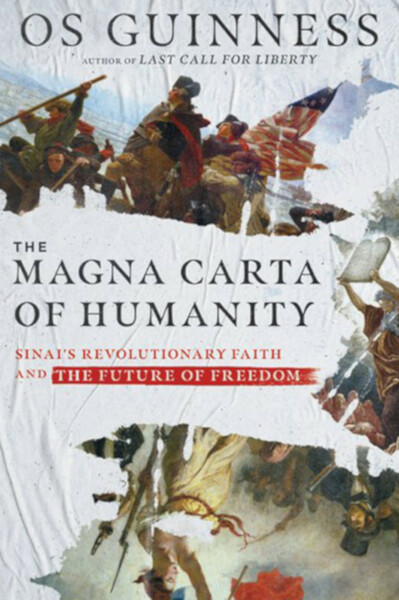
The Magna Carta of Humanity
Paris und London – diese beiden Städte verleihen dem 1859 erschienenen und während der Französischen Revolution spielenden Charles Dickens-Roman A Tale of Two Cities sein Thema. In Anlehnung an diesen inzwischen berühmt gewordenen Titel könnte man Os Guinness’ jüngstes Buch The Magna Carta of Humanity. Sinai’s Revolutionary Faith and the Future of Freedom zusammenfassend als „Eine Geschichte von zwei Revolutionen“ beschreiben. Genauer gesagt, geht es um zwei Revolutionstraditionen, die jeweils einer der beiden genannten Städte zugeordnet werden können. Auf der einen Seite steht die zunächst gescheiterte Englische Revolution von 1642 (die unter puritanischer Herrschaft ausgerufene Republik wurde 1660 wieder zur Monarchie), die aber wiederum die erfolgreiche Amerikanische Revolution von 1776 inspirierte; auf der anderen Seite steht die Französische Revolution, in deren Gefolge sich die Russische (1917) und Chinesische (1948) Revolution finden. Letztere Tradition, so Guinness, beruht auf den (anti-religiösen, säkularen) Idealen der Aufklärung, erstere steht auf biblischem (jüdisch-christlichen) Boden. Was diese beiden Traditionen voneinander unterscheidet und warum für die Zukunft der Freiheit eine Wiederbelebung der biblischen Tradition elementar ist, ist Thema des Buches: „Der zentrale Kampf ist immer noch der zwischen Sinai und Paris“ (S. 14).
Guinness beschreibt sich als Bewunderer des amerikanischen Projekts und richtet sein Buch auch primär an Amerikaner. Die USA befinden sich in einer „Krise der Freiheit“ (S. 3), die ihre Ursache darin hat, dass sich Amerika in den letzten fünfzig Jahren nicht an den Ideen der Amerikanischen, sondern der Französischen Revolution orientiert hat; die Rückbesinnung auf die Amerikanische Revolution bedeutet gleichzeitig auch eine Rückbesinnung auf den von Guinness als „Sinai-Revolution“ bezeichneten Exodus und Bundesschluss des Volkes Israel. Guinness argumentiert, dass „Paris und die progressive Linke zur Unterdrückung führen, wohingegen Sinai der wahre und wirklich revolutionäre Glaube ist, der die beste und anregendste Vision von Freiheit bietet“ (S. 14, Hervorhebung im Original).
Ein Plädoyer für die Freiheit
Die beiden sich gegenüberstehenden Revolutionstraditionen, die Guinness in der Einleitung skizziert, bilden den Rahmen seines Buches. In den verbleibenden Kapiteln diskutiert er sieben Prinzipien, von denen Freiheit abhängt. Auch wenn sich die einzelnen Kapitel thematisch-inhaltlich voneinander unterscheiden und dabei lose aufeinander aufbauen, handelt es sich im Grunde um Variationen über ein Thema – das der (amerikanischen) Freiheit. Echte Freiheit ist nur dann möglich, wenn die aus der Sinai-Revolution abgeleiteten Prinzipien heute (wieder) ernst genommen werden: „Dieses Buch ist ein Plädoyer für die Sinai-Revolution – die höchste, reichste und tiefste Vision der menschlichen Freiheit in der Geschichte“ (S. 20). Um diese Revolution für die heutigen Probleme fruchtbar zu machen, bezieht sich Guinness stark (aber nicht ausschließlich) auf die Schriften des kürzlich verstorbenen Rabbi Lord Jonathan Sacks, dem das Buch auch gewidmet ist.
„Guinness beginnt mit dem Prinzip, dass Freiheit legitimiert werden muss, also eine Autorität voraussetzt und darum bei Gott ansetzen muss.“
Guinness beginnt mit dem Prinzip, dass Freiheit legitimiert werden muss, also eine Autorität voraussetzt und darum bei Gott ansetzen muss. Mithilfe der jüdischen bzw. hebräischen Perspektive von Rabbi Sacks weist Guinness auf gewissen Nuancen biblischer Texte hin, die dem westlichen Leser möglicherweise verschlossen bleiben: So kann man z.B. Gottes Selbstoffenbarung „Ich bin, der ich bin“ auch mit „Ich werde sein, der ich sein werde“ übersetzen; zum einen wird Gott so nicht zu einem unpersönlichen (griechischen) Gott und zum anderen untergräbt dieses Gottesverständnis den Status Quo, denn der souveräne Gott wird sein Ziel erreichen und verleiht dem Glauben so seine zukunftsgerichtete messianische Hoffnung (vgl. S. 41f.). Weiterhin weist Guinness darauf hin, dass Freiheit immer eine (Be-)Gründung und Autorisierung braucht (was durch die Genesis-Deklaration, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, geleistet wird), gleichzeitig realistisch sein muss (was durch den Einbezug der menschlichen Sündhaftigkeit gewährleistet wird) und schließlich gewonnen, geordnet, kultiviert, gefeiert und weitergegeben werden muss. Auch Missstände müssen auf die richtige Art und Weise, nämliche im Geiste der Freiheit, korrigiert werden: Viele der heutigen Linken sprechen viel von Sünde, wollen aber – anders als z.B. Martin Luther King – keine Vergebung anbieten (vgl. S. 212).
Es würde den Rahmen dieser Rezension sprengen, genauer auf die vielen wertvollen und richtigen Beobachtungen von Guinness einzugehen. Gerade in seiner Auseinandersetzung mit biblischen Schlüsseltexten formuliert Guinness oft allgemeine Prinzipien, deren Berücksichtigung uns allen guttun würde. So schafft beispielsweise die bereits erwähnte Genesis-Deklaration eine Grundlage für die menschliche Existenz: Sie macht ein „Ja“ zum Leben möglich, weil die ultimative Realität, die das Universum begründet, Liebe ist (vgl. S. 85–88). Und genauso würde uns ein Ernstnehmen der „kulturellen Dynamiken der Sünde“ – das Misstrauen gegenüber Gott und dem Nächsten; der Wille, so zu sein wie Gott; und unsere Veranlagung, uns der Verantwortung zu entziehen – helfen, das Leben in Gemeinschaft zu meistern (vgl. S. 107–119).
Ein problematischer Dualismus und seine (genealogischen) Folgen
Alle diese Beobachtungen ordnet Guinness in den bereits angeführten Rahmen ein, der dem Buch seine Struktur verleiht: nämlich dem Dualismus von 1776 und 1789. Dieser Rahmen allerdings ist politisch-historisch höchst problematisch und wirft somit leider einen Schatten auf das ganze Buch. Wo genau liegt das Problem? Guinness’ Argument baut auf einer entscheidenden Prämisse auf, nämlich der absoluten Gegensätzlichkeit von 1776 und 1789: „Sinai und Paris sind völlig verschieden, und der Unterschied wird einen Unterschied machen, und diesmal nicht nur für eine Generation, sondern für die Zukunft der Menschheit selbst“ (S. 249). Ist dieser Dualismus einmal gesetzt, können (und müssen) entsprechende Genealogien konstruiert werden, die sich – genau wie die Revolutionstraditionen, in die sie münden – ausschließend gegenüberstehen. Was aber, wenn die Prämisse nun gar nicht stimmt?
Guinness’ Genealogie der Amerikanischen Revolution (Puritaner, Reformation, Exodus und Sinai) veranlasst ihn, diese ihrem Geiste nach als „biblisch“ zu konzeptualisieren. Auch wenn vor dem Hintergrund des Wiederauflebens eines „christlichen Nationalismus“ in den USA die Frage, ob Amerika als christliche Nation gegründet wurde, wieder an Brisanz gewinnt, ist die Frage keineswegs neu: Sie wurde z.B. in den 70er- und 80er-Jahren im Zusammenhang der damals aufstrebenden „Christian right“ diskutiert. Interessant ist dabei, dass Francis Schaeffer, der ja Guinness bekanntlich stark geprägt hat, zu den starken Verfechtern einer Historiografie gehörte, welche die Amerikanische Revolution in ihren Grundprinzipien als „biblisch inspiriert“ deuteten. Evangelikale Historiker wie Mark Noll und George Marsden widersprachen diesem Umgang mit Geschichte und der entsprechenden Deutung jedoch vehement.[1] Auch wenn sich Guinness in seinem Buch nicht explizit auf Schaeffer bezieht, scheint mir die Parallelität dennoch bemerkenswert. Nolls und Marsdens Kritik an Schaeffers Umgang mit Geschichte trifft genauso Guinness’ Argumentation.
„Was Guinness in seiner schwarz-weiß-Erzählung ausblendet, ist der oft komplexe, verworrene und vielschichtig verwobene Charakter von Geschichte.“
Was Guinness in seiner schwarz-weiß-Erzählung ausblendet, ist der oft komplexe, verworrene und vielschichtig verwobene Charakter von Geschichte. Natürlich haben der Protestantismus und die Bibel für die Amerikanische Revolution eine wichtige Rolle gespielt,[2] aber will Guinness ernsthaft behaupten, die Aufklärung habe Europa nie verlassen und in Frankreich nur Chaos produziert? Das 18. Jahrhundert war eine Zeit des Erstarkens eines aufklärerischen Epikureismus, der besagt, dass sich Gott – wenn es ihn überhaupt gibt – an einem weit entfernten Ort befindet und sich nicht in unsere Angelegenheiten einmischt. Die Französische und die Amerikanische Revolution entspringen beide diesem intellektuellen Klima.[3] Der in Amerika vorherrschende Deismus war vielleicht weniger radikal als ein zum Atheismus führender Epikureismus – biblisch ist dieses die 1776-Revolution prägende Gottesverständnis sicher nicht. Und auch die implizite Annahme, dass „linkes“ Gedankengut (1789) sich nicht auf das Alte Testament beziehen kann (weil diese Tradition ja schon von 1776 besetzt ist), ließe sich durch eine Reihe von Beispielen leicht widerlegen.
Auch der Historiker John Fea, Autor des Buches Was America Founded as a Christian Nation: A Historical Introduction, hat hier grundsätzliche Kritik an Guinness’ Historiografie geübt. Fea bezieht sich nicht direkt auf The Magna Carta of Humanity, sondern auf einen Vortrag, dessen Argumentationslinie jedoch der des Buches entspricht. Um die „biblische“ Amerikanische Revolution der „unbiblischen“ Französischen Revolution gegenüberzustellen, kritisiert Fea, „muss Guinness den Charakter beider Revolutionen simplifizieren und stereotypisieren. Er verkennt, dass es nie eine offizielle oder unumstrittene Auslegung der Bedeutung der Amerikanischen Revolution gegeben hat. Fea rät zur Vorsicht, wenn er anmerkt, dass Guinness „überhaupt gar keine Geschichtsschreibung betreibt“, sondern die Vergangenheit benutzt, „um eine kulturelle und politische Agenda voranzutreiben“.
Richtig in Teilen, falsch in der Summe
Wie bereits erwähnt, sagt Guinness in The Magna Carta of Humanity viele wichtige und richtige Dinge. Guinness ist dann am stärksten, wenn er allgemeine Prinzipien bespricht: die Ebenbildlichkeit Gottes des Menschen, seine gefallene Natur, die Dynamiken der Sünde. Problematisch wird es immer dann, wenn er diese Beobachtungen in die 1776-Revolutionstradition einordnet, die mit 1789 nichts zu tun hat (oder besser: haben darf). Leider setzt Guinness auf diese Weise viele an sich richtige Beobachtungen zu einem falschen Gesamtbild zusammen. Falsch ist das Bild vor allem deshalb, weil der Rahmen falsch ist: Die zwei antagonistischen, sich gegenseitig ausschließenden Revolutionstraditionen gibt es so nicht.
Buch
Os Guiness, The Magna Carta of Humanity: Sinai's Revolutionary Faith and the Future of Freedom, Downers Grove: Inter-Varsity Press 2021, 288 Seiten, ca. 22 Euro.
[1] Die Debatte und den daraus resultierenden Streit hat Barry Hankins hier nachgezeichnet.
[2] Thomas Kidd hat dazu ein ganzes Buch geschrieben.
[3] Vgl. N.T. Wright, History and Eschatology, S. 17.