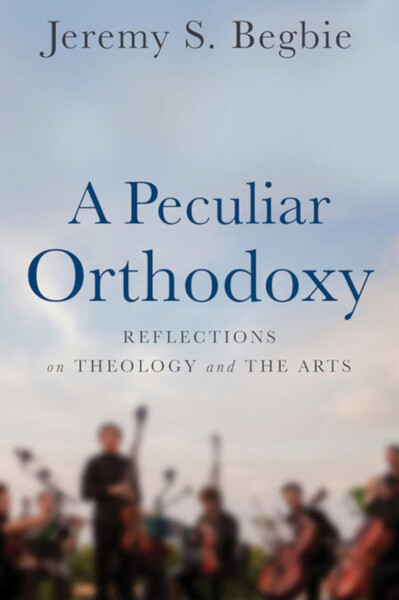
A Peculiar Orthodoxy
Das „Künste und Theologie“-Subgenre des evangelikalen Diskurses ist lebendiger als je zuvor. Es gibt unzählige Blogs, Zeitschriften, Bücher, Konferenzen und Universitätsprogramme, die sich der Erforschung der Schnittmenge von Glauben, Kreativität und Kunst widmen. Seit ich vor 15 Jahren damit begonnen habe, Filmkritiken in christlichen Magazinen zu veröffentlichen, hat mich viel von dem, was ich sehe, ermutigt. Aber einige Tendenzen der Bewegung bereiten mir auch Sorge.
Ich habe in meiner Generation viele gesehen, die ihre gesetzliche Glaubensumwelt, die den Künsten feindlich oder im besten Fall gleichgültig gegenüberstand, überkorrigiert haben. In dem verzweifelten Versuch, den gesetzlichen und unkünstlerischen Ruf des Evangelikalismus hinter sich zu lassen, sind viele von uns – ich eingeschlossen – bisweilen ins andere Extrem ausgeschlagen. Den Künsten mit einem „alles-ist-großartig!“-Enthusiasmus zu begegnen ist am Ende genauso simplifizierend wie die Gesetzlichkeit, die wir hinter uns lassen wollten.
„Den Künsten mit einem ‚alles-ist-großartig!‘-Enthusiasmus zu begegnen ist am Ende genauso simplifizierend wie die Gesetzlichkeit, die wir hinter uns lassen wollten.“
Ich habe festgestellt, dass der Künste-Theologie-Diskurs auf der Kunstseite oftmals viel robuster ist als auf der theologischen Seite. Viele an diesem Austausch Beteiligten weisen entweder nur geringe Theologiekenntnisse auf, oder aber zeichnen sich durch ein deprimierendes Desinteresse an der Bibel aus, auf die sie sich nur beziehen, wenn es ihnen passt („das Alte Testament war nicht jugendfrei, lasst uns also nicht prüde sein“) oder die sie einfach ganz weglassen. Manchmal sind die Verbindungen zwischen dem Christentum und einem Kunstwerk – vielleicht einem Banksy-Stunt oder einem Batman-Film – so weit hergeholt, dass die Frage aufkommt, ob das überhaupt noch eine Rolle spielt. Tatsächlich sollten wir nicht erwarten, dass der Austausch über die oberflächlichen Kategorien hinausgeht („positive Werte“, „erbaulich“, „erlösend“, „Christusfigur“), die lange Zeit die Hauptstützen des Diskurses ausmachten, wenn die christliche Auseinandersetzung mit den Künsten nicht von Anfang an viel stärker in der Theologie verwurzelt ist (und diese nicht mehr nur als ein heiligendes Anhängsel fungiert).
Jeremy Begbie, ein renommierter Pianist und Theologieprofessor an der Duke Divinity School, hat ähnliche Bedenken. In seinem neuen Buch A Peculiar Orthodoxy: Reflections on Theology and the Arts beklagt Begbie, dass der Künste-Theologie-Austausch zu wenig auf die Bibel zurückgreift oder sich von biblischer Orthodoxie inspirieren lässt. Begbie bemerkt, dass es die „hartnäckige Eigentümlichkeit biblisch fundierter Orthodoxie ist – die sich um die Verkörperung des Schöpfers der Welt in einem gekreuzigten König und einen Gott, der verblüffend dreifaltig ist, dreht –, die von denen, die sich heute mit den Resonanzen zwischen dem Glauben und den Künsten auseinandersetzen, viel zu leicht ausgeblendet oder zensiert wird“ (vi-vii).
In A Peculiar Orthodoxy modelliert Begbie – in einem diversen Spektrum von eigenständigen Essays – die Art der direkten, fast unverschämten Auseinandersetzung mit dieser „eigentümlichen Orthodoxie“, die vielen theologischen Schriften über die Künste fehlt. Aber wie genau sieht das aus?
Trinitarischer Ansatz
Zum einen sieht es so aus, dass man von abstrakten Einfällen zu konkreter Spezifität gelangt, wenn Christen von „Spiritualität“ und „Schönheit“ in den Künsten sprechen.
„Ein christliches Verständnis von Schönheit“, schreibt Begbie, „wird sich an einem bestimmten Gott ausrichten ... nicht an einer undifferenzierten Monade oder einer leeren ‚Präsenz‘, sondern an einer Drei-Einheit unerschöpflicher Liebe und unerschöpflichen Lebens, die der Welt als dreieinig und niemals intensiver als in dem rettenden Leben, dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi aktiv und gegenwärtig ist“ (S. 3).
Eine christliche Vision für die Künste, legt Begbie nahe, sollte viel stärker christologisch und trinitarisch sein. Sie sollte in dem auferstandenen und zum Himmel aufgefahrenen Christus den Höhepunkt der Schönheit der Schöpfung sehen. Sie sollte in ihrer Orientierung am Heiligen Geist „mit Verheißung aufgeladen“ sein und erkennen, dass die Schönheit, die wir hier wahrnehmen, „ein geistgegebener Vorgeschmack auf die Schönheit ist, die gegeben werden soll“ (S. 10).
„Eine christliche Vision für die Künste sollte viel stärker christologisch und trinitarisch sein.“
Diese trinitarische Ausrichtung ist weit davon entfernt, das Potenzial der Auseinandersetzung mit Schönheit und Kunst aus einer christlichen Perspektive einzuschränken; Begbies Buch zeigt vielmehr, wie diese Ausrichtung Möglichkeiten eröffnet und eine präzisere Sprache und kohärentere Rubriken für die Auseinandersetzung mit Schönheit ermöglicht. Eine trinitarisch geprägte Ästhetik erfreut sich unter anderem an einer „Vielfalt der Einzelheiten“ und der verschwenderischen, unberechenbaren, unbeherrschbaren Fülle der Liebe, die wir im intra-trinitarischen Leben sehen.
Form ernst nehmen
Es ist erfrischend zu sehen, wie Begbie – eine überragende Figur in der Welt der Künste und Theologie – nicht nur die Faulheit so vieler christlicher Schriften über die Künste anprangert, sondern auch elegant die Alternative modelliert: einen streng christozentrischen Austausch zwischen Kunst und Theologie – und zwar auf eine Weise, die beide bereichert.
Kapitel 8 („Room of One’s Own“) modelliert diesen Ansatz besonders gut. Begbie zeigt gekonnt, wie ein schwieriges theologisches Konzept wie die Vereinbarkeit von göttlicher und menschlicher Freiheit auf einzigartige Weise durch die Künste, in diesem Fall die Musik, beleuchtet werden kann. Der Klangraum ist ein Wahrnehmungsfeld, das sich vom visuellen Raum unterscheidet; es handelt sich um einen Unterschied, der bestimmte theologische Dilemmata hilfreich beleuchten kann. Ich liebe es, wie viel Aufmerksamkeit Begbie der Form widmet. Er respektiert die ausgeprägten theologischen Fähigkeiten und Grenzen der verschiedenen Kunstgattungen und -medien, nicht nur in dem, was sie sagen, sondern auch in der Art, wie sie es sagen.
Zu vieles in dem Kunst-Theologie-Austausch behandelt die Künste lediglich als Verpackung von Inhalten, wobei die Botschaft die primäre Ebene ist, mir der sich die Theologie beschäftigt („Funktioniert eine Figur als Christusfigur? Hat die Handlung erlösende Qualitäten? Ist ein Evangelium zu finden?“). Dem Medium selbst wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie bezeugen die einzigartigen stilistischen Fähigkeiten bestimmter Formen theologische Wahrheit? In meinem eigenen Schreiben über Filme habe ich mich herausgefordert, dieser Frage mehr Aufmerksamkeit zu schenken und über die Möglichkeiten einer christozentrischen Ästhetik des Kinos nachzudenken.
Obwohl der Schreibstil akademisch ist und es manchmal schwer fällt, zu folgen (besonders für diejenigen unter uns, die wenig musikalische Ausbildung haben), hat A Peculiar Orthodoxy jedem, der sich für die Künste und Theologie interessiert, viel zu bieten.
Zu den herausragenden Essays gehört Kapitel 2, das sich mit dem Problem der Sentimentalität im christlichen Kunstschaffen befasst (man denke an Thomas Kinkade oder an die Art christlicher Filme wie z.B. Fireproof). Basierend auf seinem christozentrischen Schwerpunkt argumentiert Begbie, dass Sentimentalität nur durch eine angemessene Betonung des Wegs des Sohnes – von der Kreuzigung am Karfreitag über den Karsamstag bis zur Auferstehung am Ostersonntag – angemessen entgegengewirkt wird. Christlicher Sentimentalismus in der Kunst, stellt Begbie zu Recht fest, entspringt oft „einem verfrühten Festhalten am Ostermorgen, einer Weigerung, den drei Tagen des Osterfestes als drei Tagen in einer unumkehrbaren Sequenz des Sieges über das Böse zu folgen“ (S. 41).
„Christen müssen die Künste so gestalten und interpretieren, dass sowohl die Dunkelheit der Kreuzigung als auch die Freude der Auferstehung, sowie die ‚schon jetzt, aber noch nicht‘-Spannungen und Sehnsüchte des Karsamstags widerhallen.“
Dieser Rahmen ist ein hilfreiches Gegenmittel nicht nur gegen die zuckersüße, billige Heiterkeit vermittelnde „direkt-zu-Ostern-springen“-Tendenz des evangelikalen Kunstschaffens, sondern auch gegen das andere Extrem, das ich oft bei jüngeren evangelikalen Künstlern sehe: eine „sich-im-Karfreitag-suhlen“-Veranlagung, die Gebrochenheit und Leiden fetischisiert, als gäbe es Ostern nicht. Christen müssen die Künste so gestalten und interpretieren, dass sowohl die Dunkelheit der Kreuzigung als auch die Freude der Auferstehung, sowie die „schon jetzt, aber noch nicht“-Spannungen und Sehnsüchte des Karsamstags widerhallen.
Was die reformierte Tradition bietet
Der abschließende Essay des Buches ist ein faszinierendes und etwas überraschendes Plädoyer dafür, dass die reformierte Tradition – die oft als kunstskeptisch und gleichgültig gegenüber Schönheit karikiert wird – tatsächlich gut positioniert ist, um das Gespräch zwischen Kunst und Theologie in eine theologisch fundiertere und fruchtbarere Richtung zu lenken.
Mit ihrer Fokussierung auf das Wort und dem Verständnis, dass die menschliche Sprache „unersetzlich immanent“ für die Selbstoffenbarung Gottes ist (S. 205), bringt die reformierte Tradition einen notwendige Fokussierung in die „Alles-ist-möglich“-Tendenzen einiger, die die Künste theologisch als eine Alternative zu den Grenzen der Sprache oder als Flucht aus ihnen positionieren. Wie Begbie im ganzen Buch argumentiert, bringen Gottes Selbstoffenbarung durch die Schrift und die Inkarnation (das fleischgewordene Wort) eine unvermeidliche Spezifizität mit sich, die auf unsere eigene Gefahr hin beiseite geschoben wird.
Aber wir müssen auch anerkennen, so Begbie, dass „der Gott, der sich die menschliche Sprache direkt für seine Zwecke aneignet, der Gott der gnädigen Freiheit ist, der alles übersteigt, was gesprochen oder gedacht, alles, was gesagt oder gedacht werden kann“ (S. 206). Hier brauchen wir Ausgewogenheit: Wir müssen anerkennen, dass die Treue zu den Realitäten der Offenbarung Gottes im Mittelpunkt stehen muss, dass eine solche Treue jedoch nicht durch die nonverbalen Künste bedroht werden muss, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen, diese Realitäten zu vermitteln:
Die Künste leisten ihre Arbeit auf ihre eigene Art und Weise, indem sie die Tiefen des Wortes des Evangeliums und unserer Erfahrung artikulieren, die sonst nicht gehört oder gefühlt werden, während sie dennoch den normativen Texten des Glaubens gegenüber verantwortlich und treu bleiben. Hier eröffnet sich ein großes Forschungsfeld, aber auch eine große praktische Herausforderung für alle diejenigen, denen die Künste in der Gemeinde am Herzen liegen. (S. 207–208)
Dies ist in der Tat eine würdige Herausforderung. Die Künste können uns in die Irre führen, wenn sie von theologischer Orthodoxie und den „normativen Texten des Glaubens“ losgelöst sind. Für zu viele gelangweilte oder anderweitig unruhige und relevanzsuchende Evangelikale hat die Treue zu den Künsten die Treue zur Heiligen Schrift überholt, wobei letztere, wenn es passt, als theologische Hülle benutzt wird, oft aber auch einfach gar nicht zur Sprache kommt. Das sollten wir besser machen.
„Die Künste können uns in die Irre führen, wenn sie von theologischer Orthodoxie und den ‚normativen Texten des Glaubens‘ losgelöst sind.“
Eine leidenschaftliche Hingabe an die Heilige Schrift und ein Gegründetsein in der „eigentümlichen Orthodoxie“ des trinitarischen christlichen Glaubens sollten der Ausgangspunkt unseres Kunstschaffens und Kunstschätzens sein, nicht ein dubioser Zusatz zur Rechtfertigung jeder einzelnen Fernsehsendung, jedes Films oder jeglicher Musik, die wir lieben. Diese richtige Orientierung wird unsere Erfahrung von Kunst nicht ersticken oder vereinfachen. Sie wird sie aufwerten und sie in den glorreichen, erleuchtenden Rahmen des letzten Referenten für Schönheit stellen: des dreieinigen Gottes.
Buch
Jeremy S. Begbie. A Peculiar Orthodoxy: Reflections on Theology and the Arts. Ada: Baker 2018. 224 S., ca. 25,00 Euro.