
Zwinglis Ethik und Spiritualität
Ulrich Zwinglis Ethik
Passend zum 500-jährigen Jubiläum der Zürcher Reformation seien hier zwei gut lesbare Bücher vorgestellt, die in ihrer Komplementarität einen anregenden Zugang zum Werk und Leben Ulrich Zwinglis vermitteln. Die Stärke beider Bücher liegt insbesondere darin, dass sie Zwingli selbst reichlich zu Wort kommen lassen.
Im ersten Buch führt Matthias Neugebauer in Ulrich Zwinglis Ethik ein. Er macht dies sehr geschickt anhand eines Dreischritts, indem er erstens einige biographische Stationen der ethischen Sensibilisierung Zwinglis herausgreift, zweitens die theologischen und philosophischen Grundlagen von Zwinglis Ethik darstellt und drittens vier lebensweltliche Konkretionen seiner Ethik aufzeigt.
Neugebauer weist gleich in der Einleitung darauf hin, dass Zwingli aufgrund seiner intensiven Auseinandersetzung mit den lebenspraktischen Fragen der Menschen über ein ausgeprägtes ethisches Sensorium verfügte. Wie Zwingli dieses ethische Sensorium entwickelt und geschärft hatte, beschreibt Neugebauer im ersten Teil anhand dreier prägender Stationen in Zwinglis Leben. Dieser Teil bietet zwar keine vollständige Biographie über Zwinglis Leben, greift jedoch einige wichtige Momente der ethischen Sensibilisierung Zwinglis heraus: seine scharfe Kritik am Solddienstwesen, seine Begegnung mit dem Humanismus, die ihren Höhepunkt in einer persönlichen Begegnung mit Erasmus fand, und seine Pesterkrankung zu Beginn seiner Zürcher Zeit.
Im Hinblick auf die Herausbildung einer dezidiert reformatorischen Ethik bei Zwingli ist der Vergleich mit der Tugendlehre des Erasmus, die dieser in seinem „Handbüchlein des christlichen Streiters“ entfaltet, von großem Interesse. Neugebauer meint zwar, dass sich auch Erasmus in seiner Schrift ganz dem reformatorischen Credo des „solus Christus“ verpflichtet gewusst habe, doch hebt er damit primär auf die Vorbildfunktion Christi ab. Zwingli hingegen sieht in Jesus Christus nicht nur das ethische Vorbild, sondern auch den Erlöser, der den Menschen in seiner ethischen Zerbrochenheit rechtfertigt und dadurch mit Gott versöhnt: „Christus ist unsere Gerechtigkeit“ (S. 70). Dies ist die Grundlage des Evangeliums, auf der Zwingli seine Ethik entfaltet.
Im zweiten Teil führt Neugebauer gekonnt in die theologischen und philosophischen Grundlagen der Ethik Zwinglis ein. Bei Zwingli greifen Dogmatik und Ethik noch ineinander, indem er die Gotteslehre mit einem güterethischen Ansatz verbindet, sowie die Anthropologie mit einem tugendethischen Ansatz. Güter- und Tugendlehre werden bei Zwingli aber nicht getrennt, sondern finden ihre Verbindung in der Lehre vom Werk und Verdienst Jesu Christi, entsprechend dessen Vermittlerrolle zwischen Gott und Mensch.
Als erstes entfaltet Neugebauer, inwiefern Zwingli Gott als das höchste Gut versteht: „Das allein ist Gott, was vollkommen, d. h. absolut ist, dem nichts mangelt und das alles hat, was dem höchsten Gut zusteht“ (S. 83). Gott als das höchste Gut weist nach Zwingli einen ethischen Charakter auf (vgl. Lk 18,19), der sich in seiner Güte und Barmherzigkeit selbst verschenkt, am deutlichsten in der Sendung seines Sohnes. Anschließend führt Neugebauer in Zwinglis Tugendlehre ein, die charakterisiert ist durch den täglichen Kampf zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen, der allgemeinen Untugend und der christlichen Tugend. Sehr bedenkenswert ist, dass Zwingli die Untugend in der Selbst- oder Eigenliebe, sprich einem unausrottbaren Egoismus, zusammenfasst. Der Mensch in seiner Untugend kreist in seinem Denken und Handeln nur um sich selbst, er ist in Eigenliebe und Selbstsucht gefangen. Er krankt an seiner gefallenen Natur (Zwingli versteht die Erbsünde im Unterschied zu Augustin als Krankheit), was sich am deutlichsten in seinem Vertrauen auf sich selbst äußert. Doch der Mensch soll sich nicht auf sich selbst, sondern allein auf Gott verlassen und ganz auf das Verdienst Christi vertrauen, der einerseits die vollkommenen Tugenden repräsentiert, andererseits „mit seinem Lebensopfer für die Menschen eingetreten ist“ (S. 97). So versteht Zwingli den Glauben einerseits als vorbehaltloses Vertrauen auf Gott, sein Wort und Jesus Christus, andererseits aber auch als klare Einsicht, dass der Mensch sich nicht selbst zum Grund unbedingten Vertrauens machen kann, darf und soll!
Des Weiteren beschreibt Neugebauer Zwinglis Verständnis von Frieden und Gerechtigkeit. Zwingli ist vom Evangelium her hoffnungsvoll genug, dass das tägliche Streben nach den christlichen Tugenden den einzelnen Christen dergestalt verändert, dass zunehmend ein innerer Friede in seiner Seele einkehrt. Dieser innere Frieden wirkt sodann auch nach außen, in Beziehungen und die Gesellschaft hinein. Zwingli ist von seinem anthropologischen Verständnis her aber auch Realist genug, um nicht eine vollkommene Realisation der christlichen Tugenden, wie sie an Jesus Christus gesehen und abgelesen werden können, zu fordern. Er weiß zu gut, dass der Mensch seine ethische Gebrochenheit nicht vollkommen überwinden kann. Darum unterscheidet Zwingli klar zwischen der göttlichen und der menschlichen Gerechtigkeit (vgl. seine gleichnamige Schrift, die ein wichtiger ethischer Text ist). Die göttliche Gerechtigkeit findet Zwingli der Tradition folgend im Dekalog und der Bergpredigt dargestellt. Die menschliche Gerechtigkeit kommt in den Rechtssatzungen eines Gemeinwesens zum Ausdruck, wobei diese nicht einfach eine billige Ermäßigung der göttlichen Gerechtigkeit darstellt. „Im Gegenteil: Es gilt, die menschliche Gerechtigkeit so weit wie möglich im Lichte der Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit zu gestalten. Ziel ist eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft, die v. a. eins ernst nimmt: die sittliche Forderung (der Bibel) und die menschliche Schwäche (hinsichtlich des Guten)“ (S. 116).
Im Anschluss an die konstatierte menschliche Schwäche stellt Neugebauer Zwinglis Position in der Debatte um den freien Willen dar. Die klassische Erbsündenlehre nach Augustin relativiert Zwingli zwar, indem er sie als Krankheit interpretiert. In diese Veranlagung zur Krankheit hineingeboren, kann der Mensch diese jedoch nicht von sich aus überwinden, so dass Zwingli deutlich festhält: „Es gibt keinen freien Willen“ (S. 124). Dem gegenüber betont Zwingli auch stark die christliche Freiheit. Einerseits besteht diese in der Befreiung von der verurteilenden und verdammenden Macht des Gesetzes, was nichts anderes als die Rechtfertigung durch Christus ist. Andererseits kann sich der Gläubige an der Freiheit des göttlichen Willens orientieren, da nur der Wille Gottes als des höchsten Gutes wirklich frei ist. Christliche Freiheit besteht also auch darin, sich den göttlichen Willen zu seinem eigenen Willen zu machen, „sich dem Gesetz Christi unterzuordnen“ (S. 129). Zwingli beschreibt diese Freiheit, die dem Prozess der Heiligung entspricht, so: „Befreiung vom Gesetz besteht also darin, dass wir aus Liebe das tun, wovon wir wissen, dass es Gott wohlgefällt“ (ebd.).
Was bedeutet dies nun für die lebensweltlichen Konkretionen der Ethik? Neugebauer stellt diese exemplarisch anhand der vier Bereiche von Ehe und Familie, von Arbeit und Müßiggang, von Staat und Obrigkeit und von Krieg und Frieden dar. Von Zwingli kann für all diese grundlegenden Lebensbereiche auch heute noch gelernt werden. Es sei etwa auf Zwinglis Überzeugung hingewiesen, dass Arbeit etwas Gutes und Göttliches sei, was bedeutet, dass der Mensch in der Arbeit „am Gutsein Gottes, an seiner Güte teilnehmen“ (S. 162) kann. Sehr bedenkenswert sind auch Zwinglis Überlegungen zu unterschiedlichen Staatsformen. Es gibt für Zwingli keine christliche Herrschaftsform an sich, sondern entscheidend ist für ihn vielmehr die innere Einstellung der Regierenden als auch der Regierten: Streben diese nach den christlichen Tugenden und somit nach dem Frieden und der Gerechtigkeit? Nach Zwingli gilt für jede Form der Obrigkeit: „Ein Staat wird nur dann kraftvoll und heilig dastehen, wenn guten Gesetzen eine gute Gesinnung entgegenkommt“ (S. 175). Damit sich eine solche gute Gesinnung im Inneren der Menschen entwickeln kann, ist jedoch die freie Predigt des Wortes Gottes unabdingbare Voraussetzung. Wird diese Freiheit durch die Obrigkeit nicht mehr gewährt, dann ist dies nach Zwingli ein legitimer Grund zum Widerstand, notfalls auch mit Waffengewalt. Dass Zwingli die Freiheit der Predigt des Evangeliums unerbittlich hochgehalten hatte, führte tragischerweise zu seinem gewaltsamen Tod auf dem Schlachtfeld.
Buch
Matthias Neugebauer. Ulrich Zwinglis Ethik. Zürich: TVZ, 2017. 228 Seiten. 29,90 Euro.
Ulrich Zwinglis Spiritualität
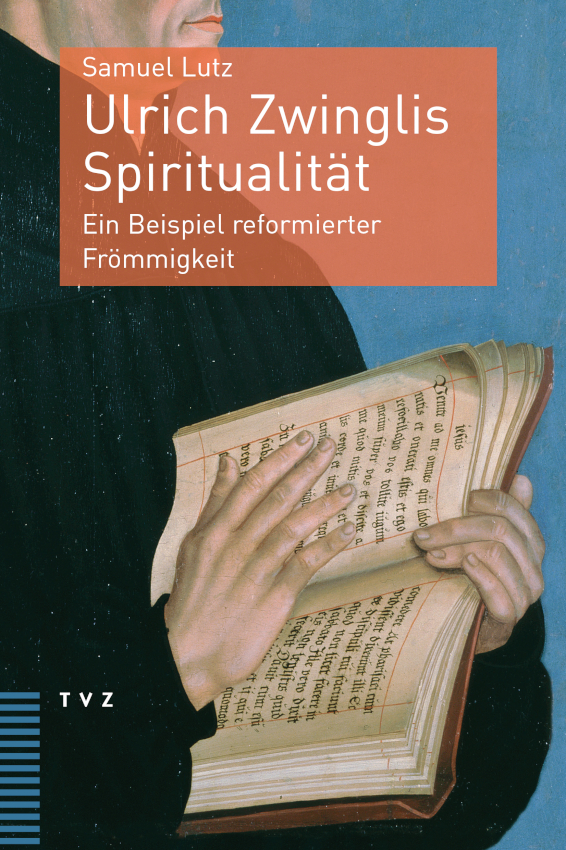
In einem kürzeren Buch beschreibt Samuel Lutz die gleichermaßen geistlich reiche wie auch im alltäglichen Leben geerdete Spiritualität Ulrich Zwinglis. Wie ist Spiritualität im Kontext einer reformierten Frömmigkeit überhaupt zu verstehen? Lutz beschreibt sie nach Zwingli „als die spürbare Zuwendung Gottes, die nicht vom Menschen ausgeht, sondern den Menschen aus Gnade widerfährt. Sie lädt dazu ein, dass sich auch die Menschen ihrerseits innerlich Gott zuwenden“ (S. 41).
Lutz gliedert seine Darstellung der Spiritualität Ulrich Zwinglis anhand von Stichworten, die er den folgenden vier Lebensbereichen zuordnet: zuerst dem persönlichen Leben, wobei sich dieses auf die Beziehung des Gläubigen zu Gott bezieht, dann dem kirchlichen Leben und dem politischen Leben und zuletzt dem alltäglichen Leben, was sich auf die Beziehungen der Menschen untereinander bezieht. Abgeschlossen wird jeder Bereich mit einer Betrachtung über das Gebet, da dieses einen wichtigen Ausdruck des Glaubens und der Zuwendung eines Menschen zu Gott und somit seiner Spiritualität darstellt. „Die von Gott ausgehende Zuwendung zum Menschen ist angekommen, wenn der Mensch zu beten anfängt. Er darf fortan an das in sein Inneres gelegte Gottvertrauen glauben“ (S. 45f.).
Die Darstellung der Spiritualität des persönlichen Lebens ordnet Lutz trinitarisch an, so dass dieses Kapitel einer kurzen und kompakten Glaubenslehre gleichkommt, die auch für die Katechese verwendet werden könnte: Gott zugeord- net sind die Begriffe Gottvertrauen, Vor- sehung, Natur, Ergebenheit, Solus Deus – Gott allein. In Bezug auf Christus werden die Themen Evangelium, Versöhnung, Gesetz und Solus Christus – Christus allein behandelt. Der Reichtum von Zwinglis persönlicher Spiritualität zeigt sich in der Fülle der Stichworte, die mit dem Wirken des Heiligen Geistes verbunden sind: Glaube, Erwählung, Vertrauen, Rechtfertigung, Beten, Verstehen, Erleuchtung, Schrift und Geist, Schrift und Glauben, Erfahrung, der innere Mensch, Wahrheit, Christen und Heiden, Solus Spiritus – allein der Geist.
Es folgen die Ausführungen zur Spiritualität des kirchlichen Lebens unter den drei Leitthemen der Kirche des Wortes (Zwingli: Wo man dem Wort Gottes Gehör schenkt, da ist noch Hoffnung), des Gottesdienstes (Zwingli: Unsere bisherigen Gottesdienste waren zahlreich, Christus aber haben sie nicht gefallen) und der Reformen (Zwingli: An Gott allein und sein Wort sollen wir uns halten).
Im Kapitel über die Spiritualität des politischen Lebens behandelt Lutz Begriffe, die bereits in Ulrich Zwinglis Ethik ausführlich erörtert wurden: Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Gewaltlosigkeit sowie Gewissensfreiheit. Im Zueinander von Kirche und Staat weist Zwingli der kirchlichen Verkündigung eine prophetische Funktion zu: „Das christliche Gemeinwesen braucht die prophetische Verkündigung“ (S. 114). Eine solche Verkündigung ist ein Wagnis, wird sie sich doch gegen den Strom stellen müssen. Doch wenn „einer es nicht wagt, mit dieser Welt in Konflikt zu geraten, wird er selber korrupt“ (ebd.).
Abgerundet wird das Buch durch einige Gedanken zur Spiritualität des alltäglichen Lebens, die zeigen, wie für Zwingli der Glaube jeden Lebensbereich durchdringt: „Das Christsein ist nicht schwatzen von Christus, sondern leben, wie er gelebt hat“ (S. 145). In diesem Satz verschränken sich die Ethik und die Frömmigkeit auf die für Zwingli typische Art ineinander und richten den Gläubigen ganz auf die Nachfolge Christi aus.
Buch:
Samuel Lutz. Ulrich Zwinglis Spiritualität. Zürich: TVZ, 2018. 160 Seiten. 23,90 Euro.